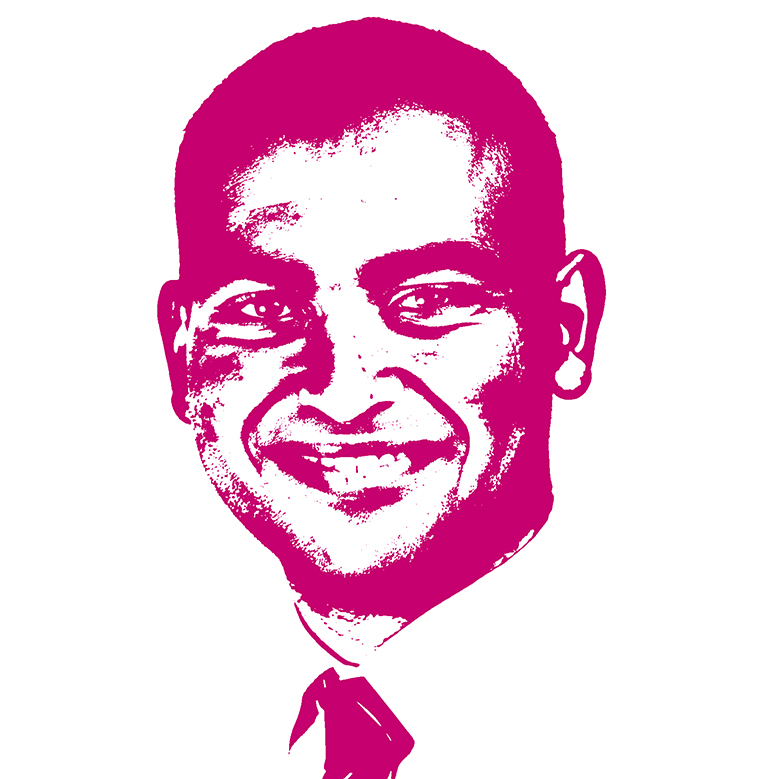ETH setzt auf Vielfalt
Diversität – also die Vielfalt innerhalb einer Gruppe – ist überall da Realität, wo viele verschiedene Menschen zusammenkommen. An der ETH gilt das ganz besonders. Doch was heisst eigentlich «divers» und wie gehen die Menschen an der ETH damit um?
Der wichtigste Punkt zur Begriffsklärung gleich zuerst: Wer von Diversität spricht, hat einen positiven Blick auf die Vielfalt in einer Gruppe. Konkret bedeutet dies, dass Unterschiede zwischen den Menschen anerkannt und geschätzt – ja sogar als Chance für die ganze Gruppe gesehen werden. Doch jedes Individuum unterscheidet sich vom anderen, die Möglichkeiten von Diversität sind deshalb theoretisch so gross wie die Anzahl der Mitglieder. Da dies wenig praktikabel ist, unterscheidet man heute meistens sechs Faktoren, die für Institutionen wie die ETH entscheidend sind: Ethnische Herkunft, Geschlecht, Alter, sexuelle Identität und Orientierung, Religion und physische oder psychische Einschränkungen.
International, männlich und jung
Um beurteilen zu können, wie es um die Diversität unter den rund 12 000 Mitarbeitenden an der ETH steht, sollte man ein paar Fakten und Zahlen kennen. An der ETH arbeiten Menschen aus 111 Nationen, 52 Prozent oder rund 6260 Personen stammen nicht aus der Schweiz. Der Anteil von Frauen ist in den letzten zehn Jahren bei etwa 35 Prozent konstant geblieben. Die meisten Mitarbeitenden sind zwischen 20 und 34 Jahre alt – diese Altersgruppe ist mit rund 7500 Menschen die grösste. Im Vergleich dazu: Nur etwa 440 Mitarbeitende sind über 60 Jahre alt – die ETH ist eine junge Organisation.Zu den anderen drei Faktoren werden bisher keine Zahlen erhoben, denn sexuelle Identität, Religion und eine körperliche oder psychische Einschränkung sind sehr persönlich. Doch dazu später mehr.
Für ETH-Präsident Joël Mesot ist die Sache klar: «Es gibt viele gute Gründe, warum Diversität für die ETH wichtig ist. Wir wissen aus der Forschung, dass diverse Teams effizienter, erfolgreicher und kreativer sind und besser auf Unvorhergesehenes reagieren können. Aber es geht um noch viel mehr. Als Hochschule haben wir eine Vorbildfunktion. Das heisst für mich, dass wir ein Klima schaffen, das fair ist, in dem ganz unterschiedliche Menschen einen Platz haben, sich akzeptiert fühlen und ihr Potenzial ausschöpfen können. Es gibt noch vieles zu tun, deshalb hat das Thema Diversität eine hohe Priorität»
ETH soll barrierefrei werden
Die Fachstelle Equal, die bisher vor allem die Chancengleichheit von Mann und Frau im Blick hatte, wird sich deshalb in Zukunft vermehrt um das Thema Vielfalt kümmern. Einige Initiativen wurden bereits lanciert wie etwa das Projekt «barrierefreie ETH». Dabei wird zunächst die infrastrukturelle und administrative Situation verschiedener Gruppen analysiert: «Wir überprüfen, ob wir ETH-Angehörige, die beispielsweise physische oder psychische Einschränkungen haben, einer bestimmten Religion oder der LGBTIQ+-Community angehören, zusätzlich unterstützen können», so Renate Schubert, die als Delegierte für Chancengleichheit Mitglied im Projektteam ist.
Aber gehen dabei die Anliegen der Frauen und ihre berechtigten Ansprüche auf Chancengleichheit nicht unter? «Nein, ganz im Gegenteil! Wenn die ETH die Bedürfnisse von verschiedenen, auch kleineren Gruppen in den Fokus rückt, Probleme erkennt und aktiv Verbesserungen anstrebt, dann entsteht eine Kultur, von der selbstverständlich auch die Frauen profitieren.» Als Beispiel nennt Renate Schubert den Abbau von Vorurteilen. Künftig können beispielsweise ETH-Angehörige, die Personalentscheidungen treffen, in Workshops lernen, die eigenen Stereotype zu erkennen und Strategien entwickeln, um damit umzugehen.
Viele Bottom-up-Initiativen
Doch Diversität lässt sich nicht einfach von oben verordnen. Umso wichtiger sind deshalb die zahlreichen Bottom-up-Initiativen, die sich für eine grössere Vielfalt und vor allem einen positiven Umgang damit einsetzen. So hat etwa die Mittelbauvereinigung AVETH seit letztem November eine Diversitätsbeauftragte im Vorstand: Iris Hordijk. «Ich fühle mich in meiner Forschungsgruppe sehr gut integriert, aber ich bin überzeugt, dass wir noch erfolgreicher wären, wenn wir mehr Frauen in der Gruppe hätten», sagt die Doktorandin. Aufgrund dieser Überzeugung möchte sich Iris Hordijk in ihrer Funktion zunächst vor allem für die Erhöhung des Frauenanteils an der ETH engagieren.
Doch nicht nur der AVETH plant, seine Aktivitäten auszuweiten und ein ganzes Diversity-Team aufzubauen, auch in verschiedenen Departementen sind unterdessen Diversity-Gruppen entstanden wie etwa am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik. Seit Anfang Jahr versucht die rund zehnköpfige Gruppe, positive Aspekte von Diversität und Inklusion greifbar zu machen. Dafür organisiert sie Seminare, zum Beispiel zum Thema «Role of Diversity in Innovation and Change», und soziale Events wie etwa einen internationalen Food Bazar.
«Neue Ideen brauchen Reibung»
Zudem gibt es auch Führungskräfte, die sich ganz bewusst der Diversität verschrieben haben. Einer von ihnen ist Ralph Spolenak, Professor für Nanometallurgie, der in seiner Gruppe zwölf Nationen, 25 bis 30 Prozent Frauen («Leider viel zu wenig», so Spolenak) und Menschen im Alter von 20 bis Anfang 60 vereint. Selbst aus einem sehr diversen Umfeld stammend ist er von den positiven Effekten einer möglichst gemischten Gruppe überzeugt: «Am wichtigsten sind für mich unterschiedliche Denkmuster. Andere soziale und kulturelle Einflüsse erweitern den Horizont und bringen mich dazu, mein eigenes Verhalten mehr zu reflektieren. Neue Ideen brauchen Reibung.»
Doch Ralph Spolenak kennt auch die Hürden. Sehr oft gehe es um die Frage, wer sich wem anpasse. Aus der Diversitätsforschung weiss man, dass kulturelle und sprachliche Barrieren Missverständnisse hervorrufen, einzelne Teammitglieder abgelehnt oder zu einer enormen Anpassungsleistung gezwungen werden können. Diversität löst deshalb auch viele Fragen aus. Soll ich mehr arbeiten, weil mein Kollege psychische Probleme hat? Was, wenn sich meine Gebetszeiten mit der Gruppenarbeit überschneiden? Und muss ich jetzt bei non-binären Menschen, also Menschen, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen, wirklich komplett auf Pronomen verzichten?
Unsichtbare Minderheiten
Um Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung kümmern sich bereits verschiedene Vereine in der Hochschullandschaft, die sich auch an der ETH Zürich für mehr Respekt und Inklusion einsetzen. Riccardo Ferrario etwa doktoriert an der ETH und ist Präsident von z&h, einem Verein für LGTBQ+-Studierende in Zürich. An unserer Hochschule fühlt er sich nicht diskriminiert aufgrund seiner sexuellen Orientierung. «Es hat sich hier viel getan in Sachen Akzeptanz. Wir stehen im Austausch mit Equal, und auch die Rektorin Sarah Springman hat ein offenes Ohr für unsere Anliegen.»
Sehr viel stiller wird es dann um religiöse Menschen und um Menschen mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen. Ihnen und anderen Minderheiten möchte «life» eine Stimme geben. Joël Mesot unterstützt das sehr: «Wer sich für die Anliegen einer Gruppe einsetzt und sich konstruktiv einbringt, trägt damit auch automatisch zur Diversität an der ETH bei – es macht unsere Hochschule vielfältiger und spannender.»
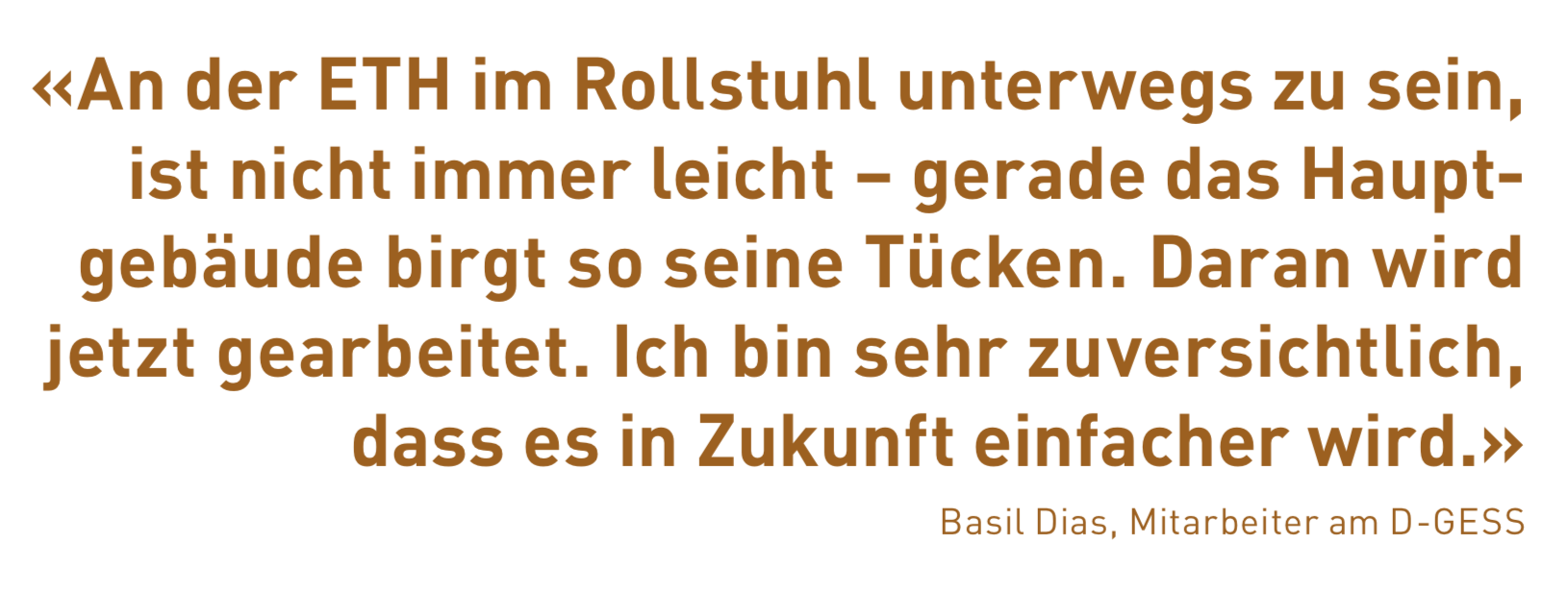
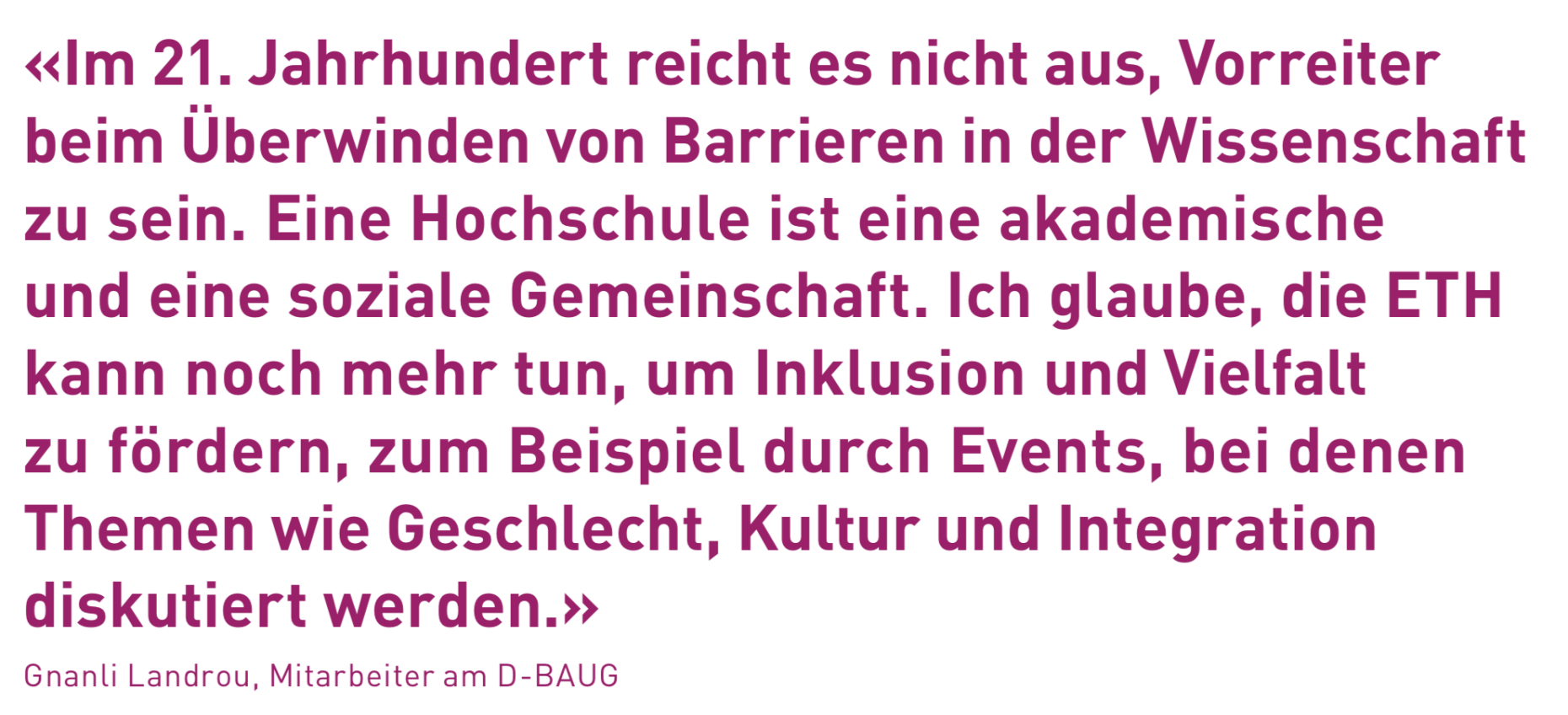
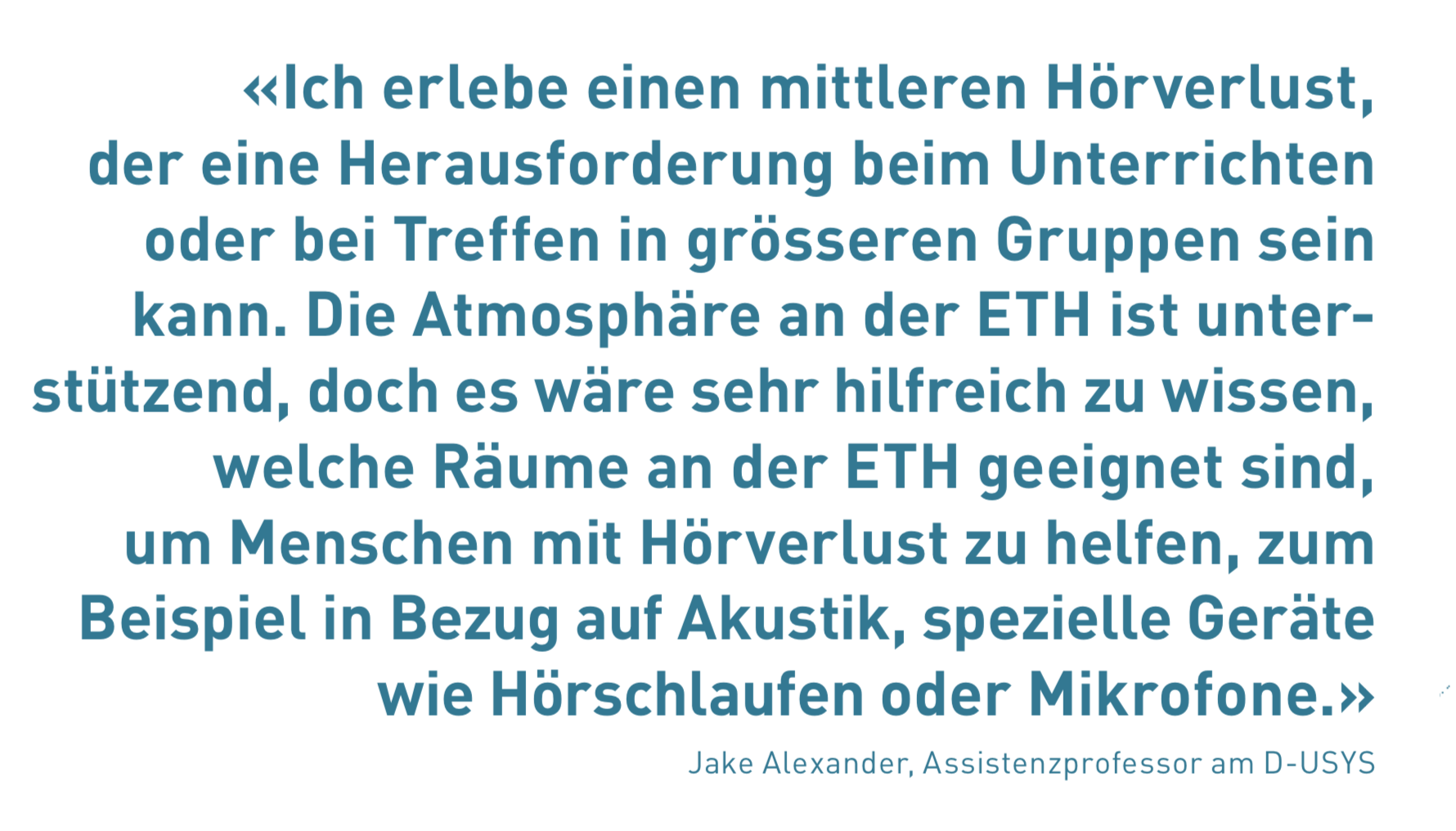
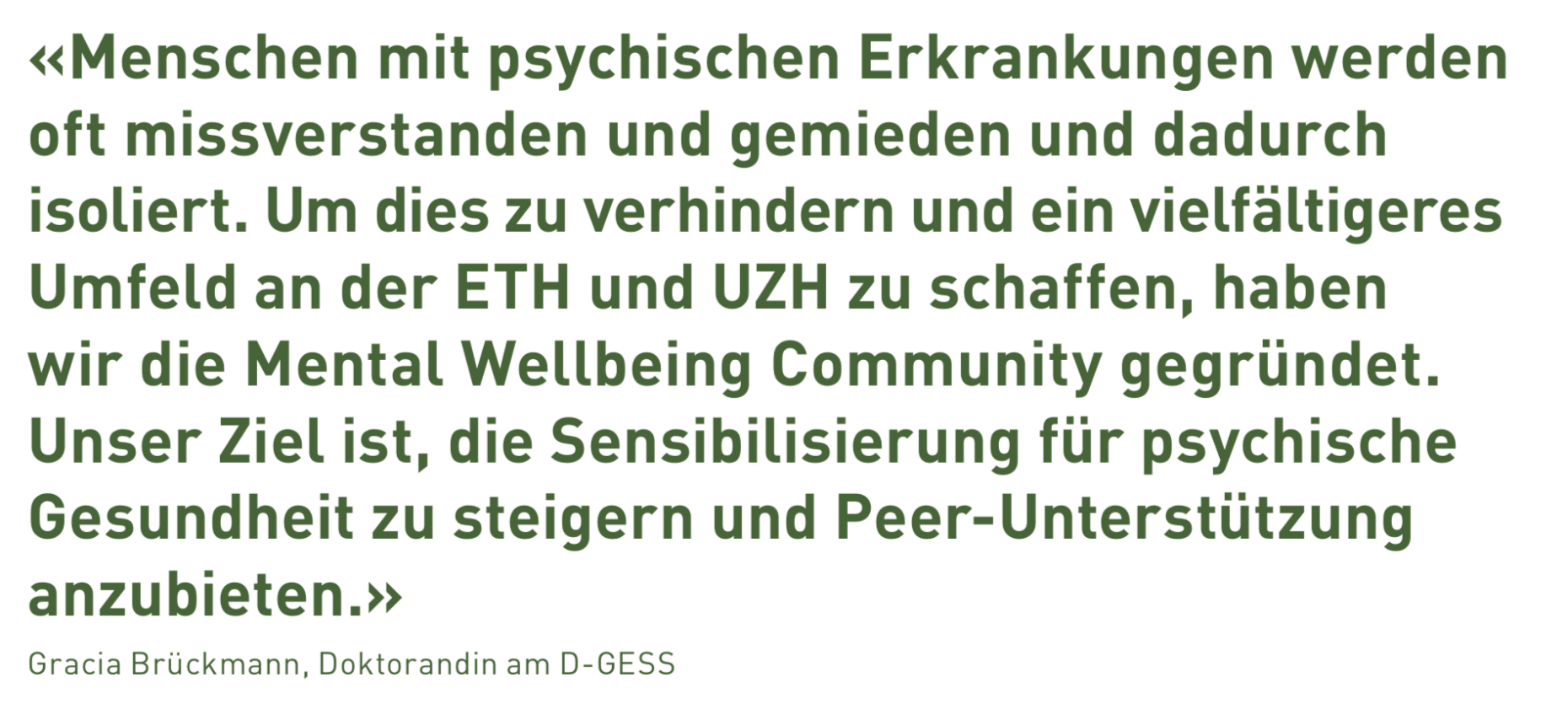


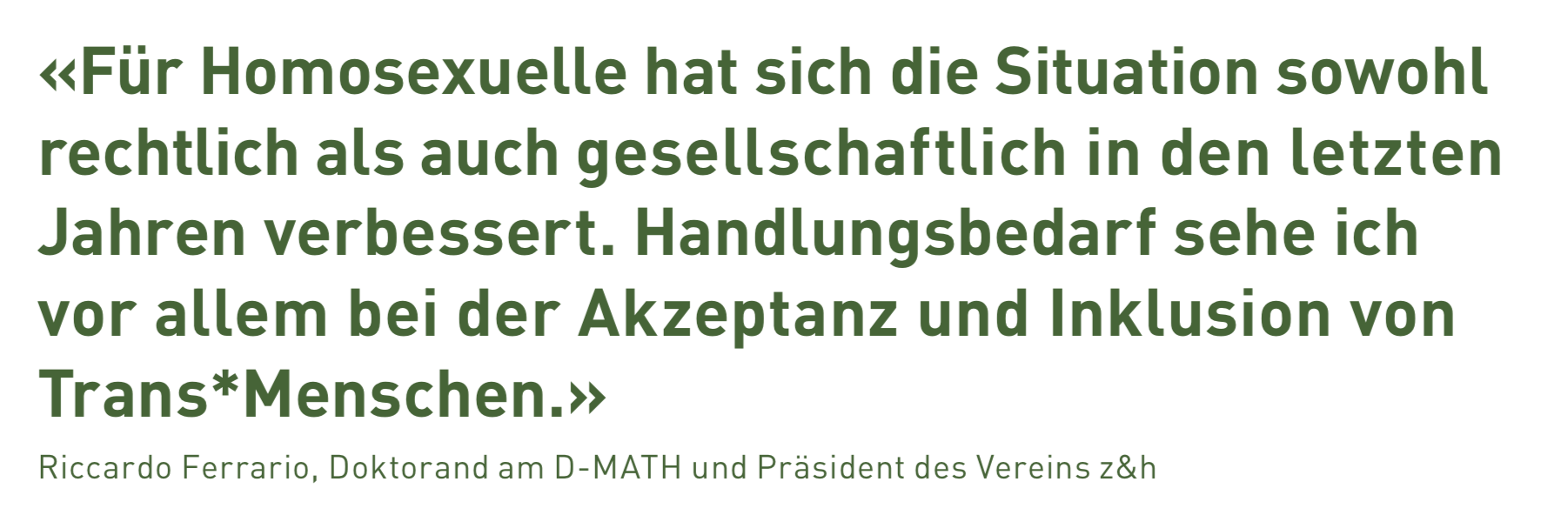
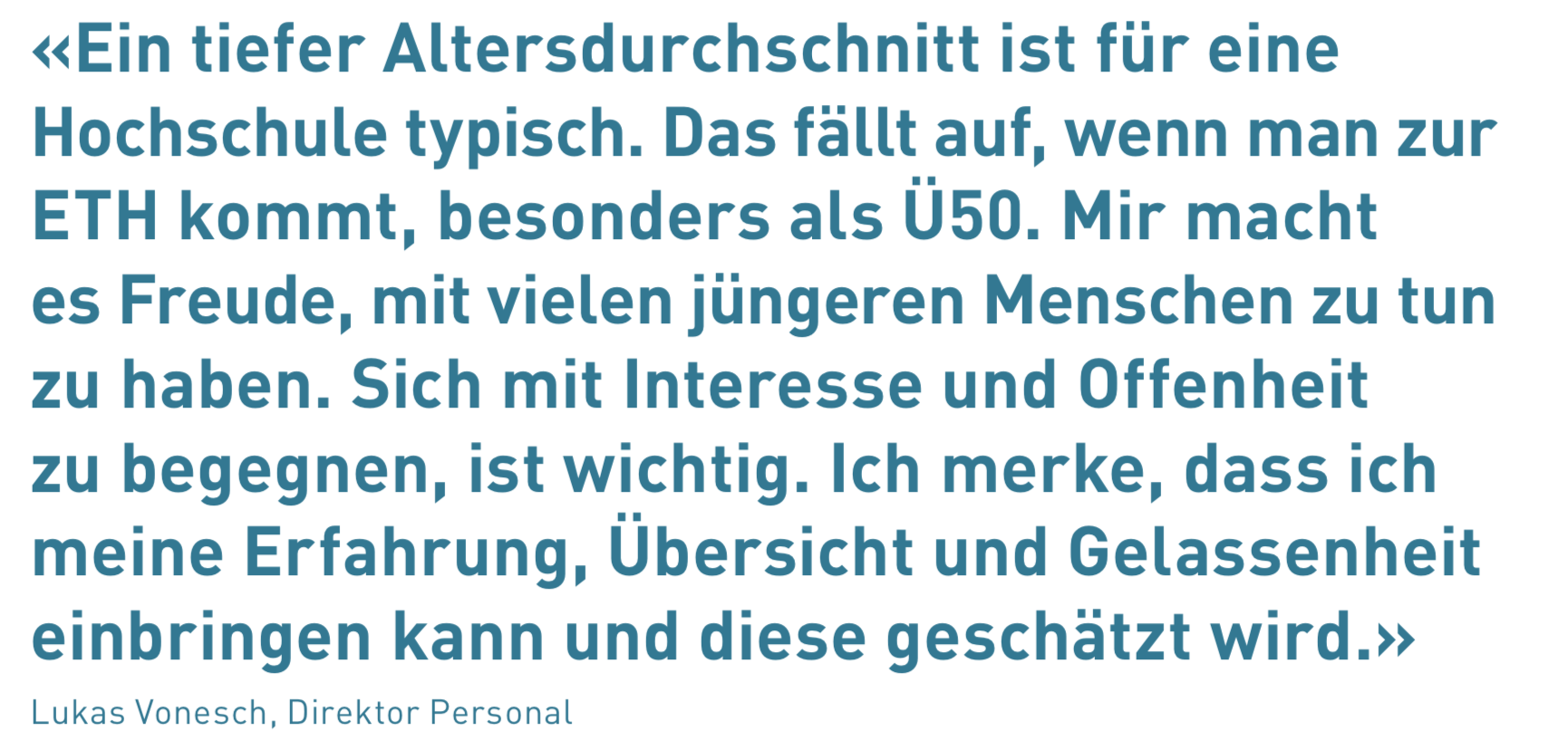
Das neue ETH-Magazin «life» ist da
Dieser Artikel ist die Titelgeschichte des aktuellen «life».