Die Personalisierte Medizin bietet nach Ansicht von Fachleuten grosse Chancen, sie bedingt aber einen breiten Austausch von Patientendaten. Dies ist eine der wichtigsten Lehren aus dem diesjährigen Latsis-Symposiums der ETH Zürich. Die Forschenden appellierten an die Politik, die Datenschutzgesetzgebung so zu gestalten, dass sie die Personalisierte Medizin nicht behindere.
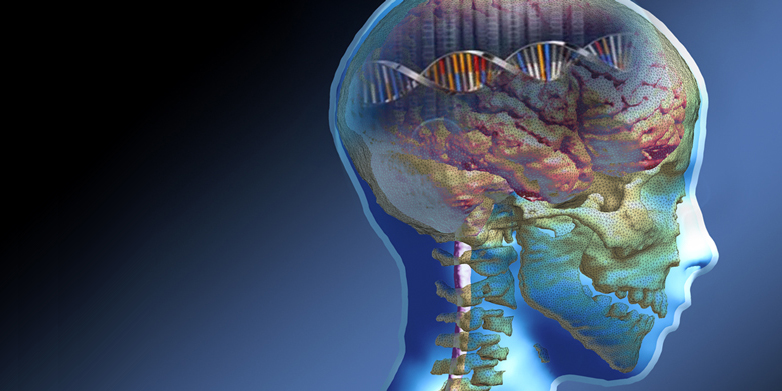
Fachleute sehen es als vielversprechende Weiterentwicklung der Medizin: Patientendaten sollen anonymisiert und standardisiert in grossen Datenbanken gruppiert werden. Interessierte Forscher und behandelnde Ärzte hätten darauf Zugriff und könnten die Daten auswerten. Dies würde die medizinische Grundlagenforschung und die Behandlungsqualität für die einzelnen Patienten in Spitälern einen grossen Schritt weiterbringen, so die Hoffnung.
Diese Hoffnung gründet auf den neuen Möglichkeiten, welche molekulare Methoden der Medizin bieten: Es ist erschwinglich geworden (und es dürfte in Zukunft noch günstiger werden), das Erbgut von Patienten, Krankheitserregern und Tumorzellen zu bestimmen, ebenso die Gesamtheit der Proteine und Stoffwechselprodukte. Medizinern stehen heute im Vergleich zu früher viel mehr krankheitsrelevante Daten zur Verfügung. Ausserdem können sie einzelne Krankheiten molekular in immer feinere Untergruppen aufteilen, die unter Umständen unterschiedliche Therapien erfordern.
Zu den Chancen und Herausforderungen dieser sogenannten Personalisierten Medizin fand in den vergangenen drei Tagen das Latsis-Symposium der ETH Zürich mit mehr als 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler statt. Mit einer öffentlichen Podiumsdiskussion gestern Abend ist die Konferenz zu Ende gegangen.
Personalisierte Medizin ist schon da
Personalisierte Medizin ist nach wie vor ein grosses Versprechen für die Zukunft – letztlich ist es ein Langfristprojekt, zu dem die Fachleute heute die Weichen stellen möchten. Doch, so wurde an der Konferenz auch deutlich: «Personalisierte Medizin machen wir schon heute», sagte etwa Roger Stupp, Direktor der Klinik für Onkologie am Universitätsspital Zürich, an der Podiumsdiskussion.
Der Bioinformatiker Thomas Lengauer, Professor am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken, berichtete an der Fachkonferenz von der Diagnose und Therapie von HIV/Aids: Heute gibt es zwei Dutzend verschiedene Aids-Medikamente, von denen in der Therapie jeweils eine Kombination von wenigen davon zum Einsatz kommt. Bereits heute wird bei Aids-Patienten die DNA des Erregers bestimmt. Computerprogramme und Statistik helfen den Ärzten, für jeden Patienten die Medikamenten-Kombination mit den höchsten Therapiechancen individuell zu ermitteln.
Daten möglichst breit austauschen
Auch in der Krebsmedizin hat die Bestimmung des genetischen Bauplans der Tumorzellen ihren festen Platz in Diagnose und Therapieplanung, wie Mark Rubin, Professor an der Cornell University, ausführte. Rubin leitet dort das Institut für Precision Medicine, das weltweit erste seiner Art. Bereits heute kämen in vielen Spitälern und Ländern Onkologen regelmässig zusammen, um gemeinsam Behandlungsmöglichkeiten für Patienten zu diskutierten, sagte er. Für ihn und andere am Symposium anwesende Fachleute lägen in einem noch breiteren Austausch von Patientendaten enorme Chancen für die Medizin und insbesondere für die Krebsmedizin.
«Die wohl wichtigste Schlussfolgerung der dreitägigen Konferenz war, dass Personalisierte Medizin einen breiten, möglichst weltweiten Datenaustausch voraussetzt», sagte Holger Moch, Professor am Universitätsspital Zürich und Co-Leiter des Kompetenzzentrums Personalisierte Medizin von Universität und ETH Zürich, zum Schluss der Konferenz.
Vergleichbar mit dem Gotthardtunnel
Ins gleiche Horn stiess einen Tag zuvor Mark Rubin: «Der Schlüssel zum Erfolg ist der Aufbau einer Infrastruktur, über die sehr viele Spitäler Daten austauschen können». Man müsse sich jedoch im Klaren sein, dass dies ein Grossprojekt sei, eine Investition in die Zukunft, vergleichbar mit der Planung und dem Bau des Gotthardbasistunnels.
Eine solche umfassende elektronische Gesundheitsdatenbank brächte eine Qualitätssteigerung in der Medizin: Ärztinnen und Ärzte, die einen Patienten mit einem spezifischen, molekular charakterisierten Tumortyp behandelten, könnten bei der Therapieplanung frühere Erfolge und Misserfolge bei vielen Patienten mit denselben molekularen Markern miteinbeziehen, allenfalls unterstützt von statistischer Auswertungssoftware.
Zu enge Schranken
Allerdings – so wurde insbesondere an der Podiumsdiskussion deutlich –, müssen auf dem Weg zu einer umfassenden Gesundheitsdatenbank Fragen des Datenschutzes und des Schutzes vor Missbrauch gelöst werden. Genom-Daten könnten persönlicher nicht sein: Mit ihnen lässt sich ein Mensch nicht nur eindeutig charakterisieren, es lassen sich daraus auch sehr viele Informationen gewinnen, etwa zur Anfälligkeit auf erblich bedingte Krankheiten.
Die derzeitige Gesetzgebung in der Schweiz und anderen Ländern weise die Medizin jedoch in zu enge Schranken, so die Ansicht der meisten Experten auf dem Podium. Sie behindere den für die Personalisierte Medizin so wichtigen Datenaustauch. Es bestehe eine Überregulierung, und dies sei das derzeit grösste Hindernis für die Personalisierte Medizin.
Vermeintlich wolle der Gesetzgeber den Patienten schützen. Er behindere aber dadurch den medizinischen Fortschritt, der vor allem im Sinne der Patienten sei. Im Klinikalltag erlebe er hingegen eine grosse Offenheit seiner Patienten, sagte der Onkologe Stupp an der Diskussion: «Die Patienten wollen einen Beitrag zur Forschung leisten. Uns Medizinern wird ein Schutzbedürfnis aufs Auge gedrückt, das nicht der Realität entspricht. Die Gesetzgebung hinkt da hinterher.»



Kommentare
Noch keine Kommentare