Lasst uns über einen Systemwandel sprechen
2020 ist Christoph Küffers fünftes Jahr (fast) ohne Fliegen. Darauf zu verzichten war einfach. Über einen gesellschaftlichen Wandel zu sprechen bleibt schwierig, bilanziert er.

Nach der Klimakonferenz in Paris in 2015 habe ich mich entschieden, nicht mehr zu fliegen. Ich habe meine Entscheidung als Selbstexperiment deklariert – ist eine internationale wissenschaftliche Karriere ohne Fliegen möglich? – und ich habe meine Erfahrungen in zwei Beiträgen auf dem ETH-Zukunftsblog diskutiert. In 2020 beginnt mein fünftes Jahr. Meine Schlussfolgerung bleibt gleich: eine internationale wissenschaftliche Karriere (fast) ohne Fliegen ist möglich.
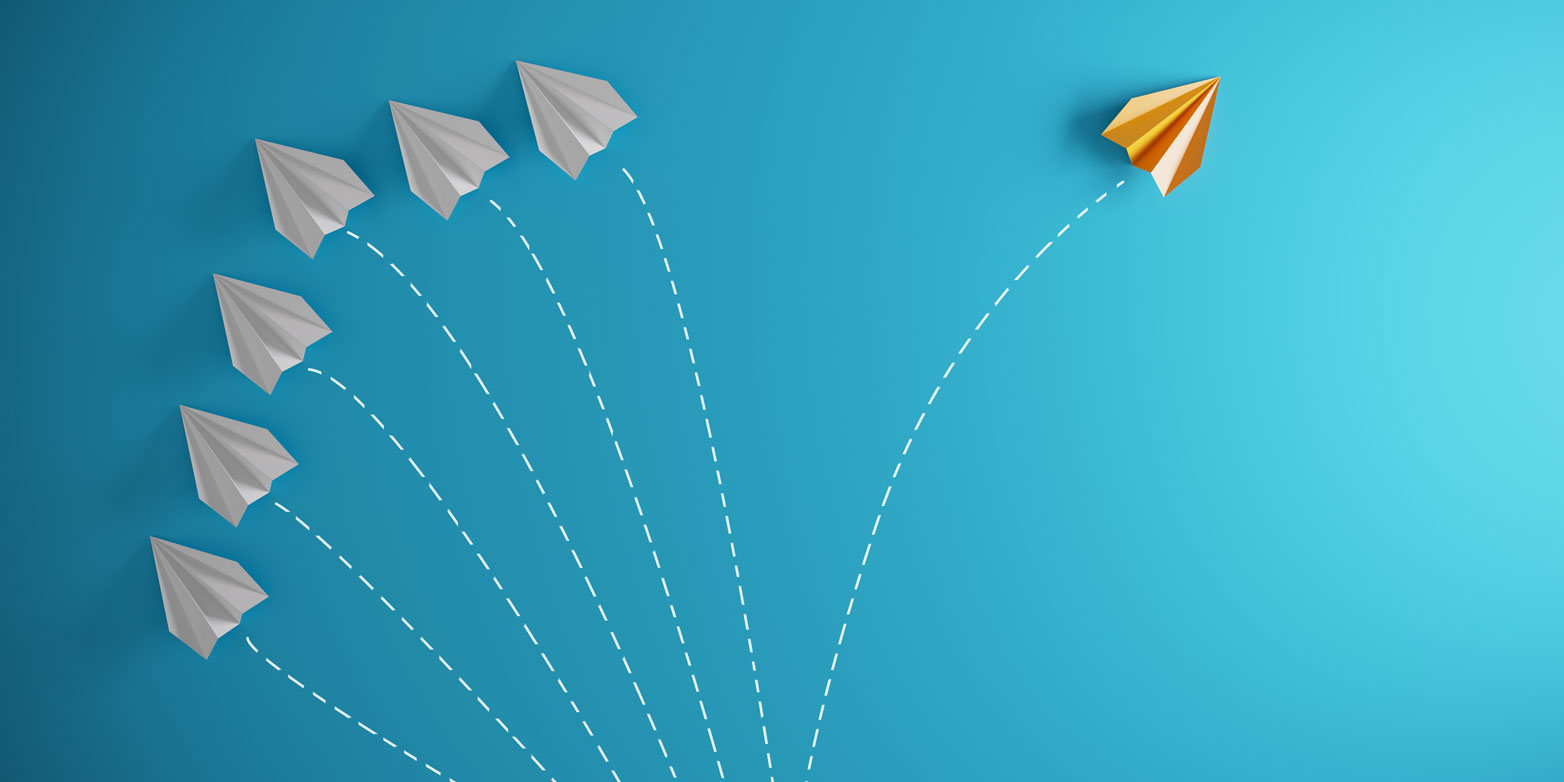
Ich fliege also nicht mehr. Zudem esse ich kaum Fleisch, besitze kein Auto und kaufe möglichst wenige Produkte. Ich lebe mit meiner Familie in einer Mietwohnung und verbringe meine Ferien in der Schweiz oder im nahen Ausland. Dieser Lebensstil kostet mich kaum Willenskraft und beschäftigt mich im Alltag wenig. Ich bin als Jugendlicher so aufgewachsen. Natürlich gab und gibt es immer wieder unökologische Ausrutscher (auch ich bin früher beruflich ein paar Mal um die Welt geflogen).
Die wahre Herausforderung
Viel schwieriger als nicht zu fliegen ist, darüber zu sprechen. Ich habe mich schwergetan, nochmals über meine Erfahrungen als nichtfliegender Wissenschaftler zu schreiben. Ich fürchte mich, dass ich (wieder) als spiessiger Ideologe oder arroganter Moralist wahrgenommen werde.
«Wieso wird Verzicht als Lebensstil in unserer Gesellschaft oft als rückständig belächelt und nicht als zukunftsorientiert empfunden?»Christoph Küffer
Mein Selbstbild sieht anders aus: Ich halte mich für neugierig, risiko- und lebensfreudig, weltoffen, sozial vernetzt, urban und innovativ. Wieso wird Verzicht als Lebensstil in unserer Gesellschaft (die über ihren Verhältnissen lebt) oft als rückständig belächelt und nicht als zukunftsorientiert empfunden?
So erwische ich mich des Öfteren dabei, wie ich im Alltag mit ironischem Unterton über meine «altertümliche» Lebensweise spreche. Insgeheim hoffe ich, dass niemand lacht, wenn ich am Bahnhof nach dem Fahrplanaushang suche, weil ich kein Smartphone besitze. Für Absagen von akademischen Einladungen, welche einen Flug erfordert hätten, habe ich auch schon Ausreden verwendet, ohne meinen wahren Grund zu nennen.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich stehe in Beruf und Alltag für meine Überzeugungen ein. Aber kein Wissenschaftler will als fortschrittsfeindlich gelten.
Modelle für ein nachhaltiges Morgen
Unsere Gesellschaft hat es verlernt, über andere Lebensformen und soziale Utopien zu sprechen. Das wird sich dank der Klimajungend hoffentlich bald ändern. Wollen wir im entscheidenden Jahrzehnt der 2020er Jahre eine radikale Umkehr bei CO2-Ausstoss, Ressourcenverbrauch und Artensterben schaffen, dann müssen wir über einen Systemwechsel und die Konsequenzen für unser Alltagsleben reden.
Viele von uns hoffen, dass wissenschaftlicher Fortschritt alleine die Probleme wegzaubern wird. Doch das wird kaum möglich sein, schon gar nicht für die Milliarden Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern, die auch von den Versprechen der Konsumgesellschaft träumen. Technologische Innovationen und Digitalisierung werden Lösungen bringen, aber wir brauchen insbesondere auch soziale Innovationen, also neue Formen des Zusammenlebens und des Wirtschaftens. Kurz: Wir brauchen Visionen für eine nachhaltige Gesellschaft.
Gold für den Zukunftsblog
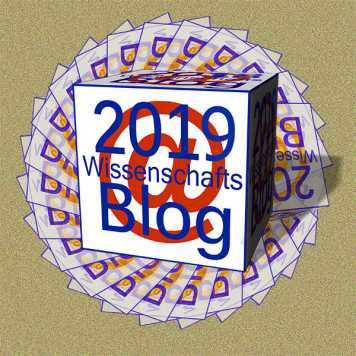
Unser Blog wurde zum «externe Seite Wissenschafts-Blog des Jahres 2019» in Gold gewählt. Das Redaktionsteam bedankt sich bei allen Leserinnen und Unterstützern.
Auch die (technischen) Universitäten sind mitschuldig an der lähmenden Sprach- und Orientierungslosigkeit unserer Gesellschaft. Man spricht lieber von einer futuristischen Zukunft dank technologischer Revolutionen als über gesellschaftliche Veränderungen. In der Schweiz gibt es aktuell keine grossen Forschungsprogramme oder Institutionen zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft, einer Kultur der Nachhaltigkeit oder alternativen Wirtschaftssystemen.1
Mein Neujahrswunsch
Derweil tun wir Expertinnen und Experten so als wüssten wir, was richtig und falsch ist. Die Eine sagt, dass Fleischverzicht wichtiger sei als Flugscham, der Nächste sieht Plastikabfall als überbewertet, während die Dritte meint, dass Wirtschaftswachstum unverzichtbar sei. Mit solchen vermeintlichen Antworten lassen wir wenig Raum zum Weiterdenken. Wir sollten uns vielmehr den fundamentalen Fragen stellen und verstärkt den kritischen gesellschaftlichen Dialog fördern.2
Und so lautet mein Neujahrswunsch: Lasst uns frei von Verlustangst über die Zukunft sprechen. In 30 Jahren werden wir in einer fundamental anderen Welt leben. Noch können wir diese mitgestalten. Die kommende Dekade wird dafür entscheidend sein.
Dieser Text erscheint auch als externe Seite Meinungsbeitrag im Tagesanzeiger.
Referenzen
1 Im Vergleich beispielsweise zu Deutschland, z.B. externe Seite Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung IASS, externe Seite Rachel Carson Center for Environment and Society oder externe Seite Reallabor-Forschung in Baden-Württemberg.
2 Was damit gemeint sein könnte, diskutiert dieser Artikel: Kueffer, C., Schneider, F., Wiesmann, U. 2019. externe Seite Addressing sustainability challenges with a broader concept of systems, target, and transformation knowledge. GAIA 28(4): 383-385.
Kommentare
Es sind zusätzliche Kommentare in der englischen Fassung dieses Beitrags verfügbar. Alle Kommentare anzeigen
Mit ausschliesslich technischen Mitteln lässt sich der Klimawandel nicht aufhalten. So vermag etwa das Elektroauto die Umweltprobleme nicht zu lösen. Es ist höchst unglaubwürdig, wenn Umweltfachleute ständig in der Welt herumfliegen und das Davoser WEF von Nachhaltigkeit plaudert. Ohne Verzicht geht es nicht. Ich lebe seit bald 40 Jahren autofrei und habe diesen Schritt noch nie bereut. Seit über zwanzig Jahren bin ich nicht mehr geflogen. Verzicht kann auch eine Bereicherung bedeuten. Verzicht auf Auto und Flugzeug verunmöglicht eine erfolgreiche wissenschaftliche Tätigkeit keineswegs. Mein zweibändiges Werk "Meilensteine der Rechentechnik" bzw. "Milestones in Analog and Digital Computing", das in Kürze in der 3., völlig überarbeiteten und stark erweiterten Auflage (je 2000 Seiten, >700 Abbildungen, >150 Tabellen) bei De Gruyter Oldenbourg (Berlin) bzw. Springer Nature (New York) erscheint, berichtet in Wort und Bild über Errungenschaften aus der Geschichte der Mathematik, der Informatik, des Automatenbaus, der Robotik und wissenschaftlicher Instrumente aus den Bereichen Astronomie, Vermessung und Zeitmessung. Das Buch vermittelt einen globalen Überblick und gilt weltweit als das umfangreichste Werk zur Geschichte der Rechentechnik. Milestones in Analog and Digital Computing Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2000 pages https://www.springer.com/de/book/9783030409739call_made Dozent i.R. am Departement für Informatik der ETH Zürich
Nur wer sein Arbeitsumfeld selber gestalten kann, ist in der Lage zum Verzicht. Unsere Wirtschaft und der Staat fördern jedoch die bisherige Lebensweise. Die formellen Anforderungen an Jobs steigen stetig, für viele KV-Jobs werden Bachelor-Abschlüsse gewünscht und gefordert. Bei Arbeitsverlust verlangt das RAV dass bis zu 4 Stunden Arbeitsweg pro Tag in Kauf genommen werden muss. Oft muss der Arbeitnehmer auch über die Arbeitszeit hinaus erreichbar sein. Business-Dresscodes erfordern zusätzliche Bekleidung. Flexibles Arbeiten und Home-Office sind Aussnahmen in der Industrie. Nur wenn das System mittels neuen Gesetzen zur Änderung gezwungen wird, kann auch der Normalbürger seinen Beitrag leisten. Wie wäre es, wenn der Arbeitsweg zur Arbeitszeit gilt? So wird gewährleistet dass Unternehmen Mitarbeiter aus der Umgebung bevorzugen. Löhne schweizweit harmonisiert und nach Ausbildung, Erfahrung und Leistung öffentlich kommuniziert werden. Immobilien als Anlagen durch Regulierung der Mieteinnahmen unbeliebter gemacht werden.
Hier mein Plan zur Lösung des Klimaproblems: https://nordborg.ch/2019/12/29/lets-solve-the-climate-crisis-in-2020call_made. Dieser erfordert kein Umdenken. Ich jetzt auf der Suche nach Partnern für die Ausarbeitung der Details.
In meinem bis jetzt 65-jährigen Leben lagen zwischen zwei Flugreisen im Schnitt rund 8 Jahre ganz (nicht fast!) ohne Fliegen. Der "Verzicht" war nicht "einfach" – sondern es war gar kein Verzicht: Ich bin nämlich geflogen wann immer ich es wollte; so werde ich es auch weiterhin halten. – Was ich damit sagen will: Wir "retten die Welt" nicht durch Selbstkasteiung; sondern zum einen, indem wir uns ganz locker und wie von selbst "umweltgerecht" verhalten. Zum anderen aber auch, indem wir an nachhaltigen Technologien arbeiten: CO2-neutrale Flugzeug-Antriebe; nachhaltige Fleischproduktion (vielleicht gar in vitro?); etc. etc.
Ihr Beitrag fasziniert mich, Herzlichen Dank! Das Humane wird seinen Platz finden. Da bin ich mir fast sicher-;)
Sehr einfach, Ihr Lösungsansatz
Einen radikale Umkehr beim CO2-Ausstoss bis 2050 erreichen wir nur über eine radikale Abkehr von Kohle,Öl und Erdgas und nicht über einen Systemwandel. Grund: Eine Kultur des allgemeinen Verzichts (Verzicht auf Konsum, Reisen, Medizinische Behandlung (weil zu teuer), etc) wird sich global nie durchsetzen, sondern allenfalls bei einer Gruppe von Gleichgesinnten (wie schon beim Kommunismus). Die (Zitat) "Milliarden Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern, die auch von den Versprechen der Konsumgesellschaft träumen", die werden sich diese Träume erfüllen und Länder wie China, Vietnam und andere sind schon dabei dies zu realisieren. Nur: Konsum, Reisen, Medizinische Betreuung und fast alle andere Wirtschaftstätigkeiten sind auch ohne CO2-Emissionen möglich. Wer den Klimawandel durch Treibhausgasse stoppen will, der muss nur auf etwas verzichten: Auf CO2-Emissionen. Das heisst keine Öl- oder Erdgasheizung, kein Auto mit Verbrennungsmotor, kein Flug mit kerosinbetriebenen Flugzeugen. Wer dagegen auf eine neue Wärmepumpe verzichtet, weil er auf Neuanschaffungen verzichten will, der erfüllt vielleicht das Anforderungsprofil der neuen Verzichtskultur, doch er verstösst gegen das wichtigste Prinzip bei der Bekämpfung des Klimawandels: Keine CO2 Emissionen mehr - auch dann nicht, wenn es eine neue Anschaffung nötig macht und man damit weniger verzichten kann.
Das Grüne Paradoxon https://www.youtube.com/watch?v=DKc7vwt-5Hocall_made - als Denkanstoss. Wunderbarer Vortrag vom Herrn Hans-Werner Sinn zum C02-Verbrauch als Anstoss.