Betrachtungen eines Banausen
Will Anders
Auf der Suche nach einem beheizten Raum betrat Will Anders vergangenen Winter erstmals das ETH-Zentrum. Leider war das Foyer dann doch nicht so warm, wie er sich das vorgestellt hatte. Trotzdem blieb er, weil er nichts Besseres zu tun hatte. Ursprünglich Teilzeit-Tabakwarenverkäufer, versuchte sich Anders Ende des 20. Jahrhunderts nach einer vorzeitig abgebrochenen Laufbahn als Strassenpantomime kurzzeitig in der Rolle eines Kleintiererziehers. Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten hält er nun Ausschau nach einer neuen Herausforderung. Im Auftrag der Critical-Thinking-Initiative betrachtet Anders die ETH Zürich von allen Seiten und berichtet regelmässig von seinen Beobachtungen und formuliert dabei selten sonderlich ausgereiften Gedanken.
# 11:
Das Alte Testament befeuert den Fortschritt und damit den Niedergang. Amen.
«Am siebten Tag sollst du ruhen», sagt die Bibel. Und ergänzt in gewissen Übersetzungen, dass dies auch für Ochs und Esel sowie den Sohn der Haussklavin zu gelten habe (die Sklavin selber bleibt unerwähnt). Die Universität Zürich wurde während vieler Jahre seit ihrer Gründung von Theologen geleitet, das hatte Tradition. Der ETH nebenan war die Theologie hingegen stets fremd. Gott hatte in den Naturwissenschaften nichts verloren.
Kein Wunder also stellte der Valora-Konzern einen automatisierten Lebensmittelladen nicht etwa in den zwinglianisch besudelten Irchelpark sondern auf den Campus Hönggerberg. Denn dort wird nicht geruht, ausser beim Personal der kleinen Coop-Filiale.
Mit dem automatisierten Shop ist er wahrgeworden, der Traum eines jeden Detailhandelsunternehmens: Unabhängig von lästigen Gesetzen zum Schutz der Angestellten Umsatz generieren. 24 Stunden, sieben Tage.
Dass dies nur mit Maschinen, nicht aber mit menschlichem Verkaufspersonal gelingt, ist dem Arbeitsverbot an Sonntagen geschuldet. Auch wenn dieses längst aufgeweicht worden ist. Trams und Züge, Flugzeuge, Polizei und Feuerwehr, Bäckereien – deren Personal arbeitet auch dann, wenn Gott persönlich es verboten hat. Dasselbe gilt für Angestellte in Geschäften an Bahnhöfen und Flughäfen, in touristischen Zentren, sowie diverse Restaurants jeglicher Güteklasse und – vor allem – Pfarrer, die in dieser Hinsicht Wasser predigen und mit Messwein gurgeln.
Über die Frage, wann, wo und was an Sonntagen verkauft werden darf, grübelt regelmässig das höchste Schweizer Gericht in Lausanne. Gelegentlich bis ins Detail, etwa zur Frage, ob Damenstrümpfe, Windeln, Bodylotion und Batterien Artikel sind, die Reisende dringend oder weniger dringend benötigen. Wobei keineswegs individuelle Notlagen, sondern kollektive Bedürfnisse im Vordergrund stehen.
Keine Frage, der akademische Nachwuchs sieht sich gelegentlich genötigt, an Sonntagen den Laptop anzuwerfen. Dass angesichts dieser gefühlten Notwendigkeit die Zubereitung des obligaten Sonntagsbratens leidet, lässt ein Dilemma entstehen: Weil die nichtregulierte Sonntagsarbeit Realität ist, kollidiert sie mit der ebenfalls realen regulierten. Nämlich dann, wenn die Masterstudentin im Labor tüftelt und ihr Magen derart laut knurrt, dass die Moleküle in der Petrischale zittern (und auf diese Weise die Versuchsresultate verfälschen).
Aber das ist ja alles kein Problem. Die Grossverteiler haben ja bereits gezeigt, dass wir Konsumentinnen in der Lage sind, Supermarktkassen selber zu bedienen. Da ist es nur ein kleiner Schritt, bis das restliche Personal ebenfalls entfernt worden ist.
Geniessen wir also unsere neu gefundene Autonomie bis die Automatisierung unsere Jobs verschwinden lässt und wir nicht einmal mehr Klos putzen gehen können, weil die das auch gleich selber erledigen.
Unsere einzige Hoffnung ruht auf den bislang noch nicht erfundenen Algorithmus-Ethikerinnen, ein Beruf mit Zukunft. Wenn die definieren, dass Arbeitsgesetze auch für nichthumane Intelligenz gelten dürften auch Robotern ein eigener Sabbat zugestanden werden. Und wenn am siebten Tag die Automaten ruhen, können wir Menschen wieder ans Werk gehen.
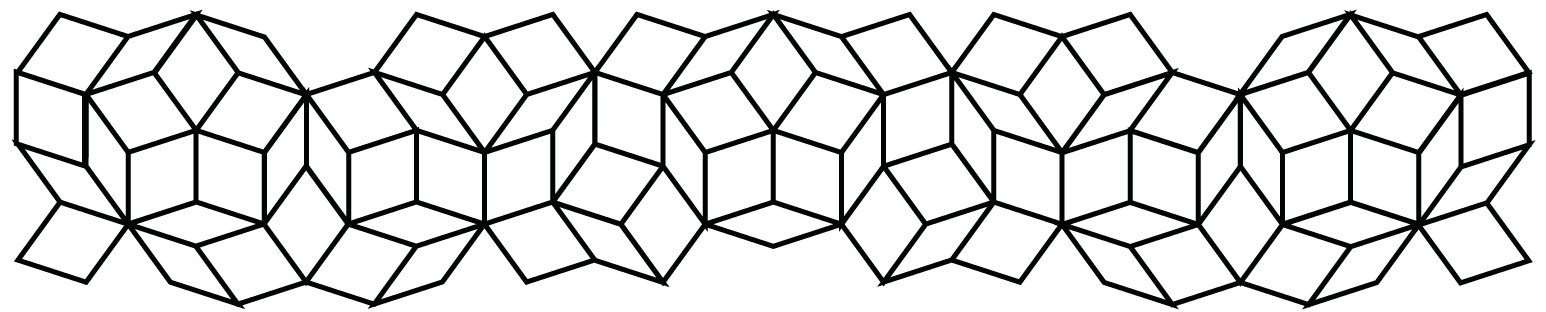
#10:
Die Antimaterie zur Intelligenz
Wer es schafft, an einer der weltbesten Hochschulen zu studieren oder gar zu unterrichten, muss zwingend intelligenter sein als das Gros seiner Spezies. Auch wenn wir alle anderen Faktoren wie den sozialen Stand qua Geburt, das Glück, den Fleiss und so weiter weglassen, die Intelligenz muss einem Mindestlevel genügen, und der ist zwingend hoch.
Doch was ist Intelligenz? Das Wörterbuch definiert sie als Fähigkeit abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten. Ein Blick auf den durchschnittlichen Erfahrungsschatz eines mittleren Menschen lässt allerdings Zweifel an der Anwendbarkeit dieser Definition aufkommen. Gerade Menschen, denen man eine hohe Intelligenz attestiert, punkten nicht immer in der Kategorie Vernunft. Und schon gar nicht ist all das, was hoch intelligente Menschen den ganzen Tag so machen, auch zweckvoll. Es handelt sich bei also um ein Idealbild, dem intelligente Menschen oftmals nicht genügen, obwohl sie nachweislich – also in Zahlen ausgedrückt – eine hohe Intelligenz besitzen.
Doch nun folgt die nächste Frage: Was ist Dummheit? Die einfachste Antwort lautet: Die Absenz von Intelligenz. Das ist allerdings keine befriedigende Erklärung. Denn Intelligenz kann hoch, mittel oder tief sein. Selbst wenn sie besonders tief ist, ist sie noch da. Sprich, auch ein dummer Mensch besitzt eine gewisse Intelligenz, auch wenn sie so niedrig ist, man sich peinlich berührt von dieser Person abwenden will. Das heisst, wenn Intelligenz nicht nicht da sein kann, muss sie mit der Dummheit koexistieren können.
Das würde zumindest erklären, weshalb auch sehr intelligente Menschen grosse Dummheiten begehen können. Ein solcher Mensch kann zu seiner Verteidigung nicht einfach den IQ vorlegen und damit beweisen, dass er unmöglich dumm sein kann, ergo seine Handlung kein Ausdruck von Dummheit ist.
Wir sind deshalb dazu verdammt, auch als (ich unterstelle uns das jetzt pauschal) überdurchschnittlich intelligente Menschen demütig einen Umgang mit unserer eigenen Dummheit zu finden. Nur, wenn wir sie als etwas Integrales verstehen und uns (auch) Schwäche voll bewusst sind, können wir vielleicht dem Anspruch an die Intelligenz ein bisschen genügen. Und – eben – zweckvoll, vernünftig zu handeln.
Im Wissen darum, dass wir wohl nie so intelligent sein können, wie der intelligenteste Mensch auf dem Planeten. Aber dass wir jederzeit das Potenzial haben, den Preis des dümmsten Individuums zu gewinnen.
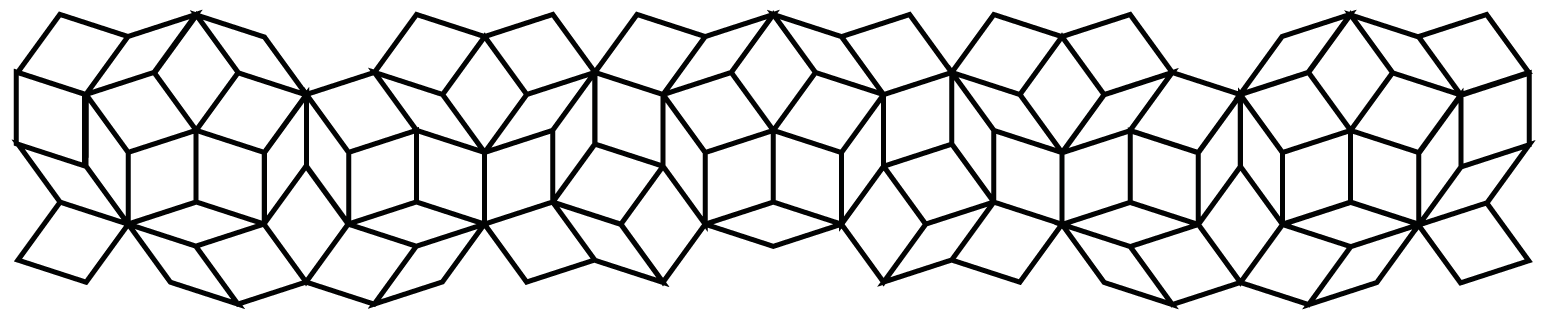
#9:
Die fast übersehene Träne einer vergessenen Gestalt
Am Nachmittag des 28. März dieses Jahres geschah an der Nordfassade des ETH-Hauptgebäudes etwas, das der Wissenschaft noch lange Rätsel aufgeben wird. Passanten beobachteten, wie aus dem Auge einer auf die Mauer gemalten Figur eine Träne kullerte.
Derartige Vorgänge sind bislang nur von Marienstatuen an Wallfahrtsorten bekannt. Gelegentlich handelte es sich dabei um Orte, die erst nach der Entdeckung einer Marienträne zu einem Wallfahrtsort wurden. Es dürfte sich also vereinzelt um Fälle von religiösem Marketing gehandelt haben.
Nicht so an der ETH-Nordfassade. Bei der weinenden Figur handelte es sich um «Artes», die Personifizierung der Künste, die zusammen mit ihrer Kollegin «Scientiae» als Co-Schirmherrin der technischen Hochschule amtet. Sie wurden in der Absicht gemalt, dass an diesem Institut beide zu Höchstform auflaufen sollen.
Der Grund für Artes’ Träne dürfte in den Vorgängen liegen, die sich zeitgleich einige Kilometer entfernt auf der anderen Seite von Limmat und Sihl zutrugen. In einem zusammengeflickten Bröckelbau, der sich «Zeughäuser» nennt und Teil des maroden Kasernen-Ensembles ist. Hierhin hatte die Critical Thinking Initiative zum «Markt» geladen.
Nun lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich bei der aus Artes’ Auge triefenden Flüssigkeit um eine Freudenträne oder eine der Trauer gehandelt hat. (Auch der Salzgehalt wurde nicht bestimmt.) Für die Freudenträne spricht, dass an jenem Nachmittag einige Projekte vorgestellt wurden, die Grund zur Hoffnung geben. Hoffnung, dass die Ketten der Konformität, des Immergleichen, des Man-hat-das-schon-früher-so-gelöst doch hier und da gesprengt werden.
Für die Freudenträne sprechen einige der vermittelten Inhalte: Studentinnen, die statt Papier Filme produzieren. Oder die ihre schriftlichen Arbeiten nicht für die Schublade verfassen, sondern eine Buchreihe herstellen. Und dabei so schreiben lernen, dass irgendwer das Resultat auch dann liest, wenn er oder sie gar nicht müsste.
Wer nicht die Neugier in sich selbst entdeckt, wird nie wissen, ob Morgenyoga Glücksgefühle beschert und was der Unterschied zu Abendyoga ist. Oder was wir vom Soziallebens des Grossen Tümmlers im Indopazifik lernen können. Wer den ganzen Tag nur über Maschinen nachdenkt, vergisst möglicherweise irgendwann, dass er eigentlich Mensch ist.
Es gibt keine wichtigen und unwichtigen Fragen. Alles hängt zusammen, alles ist verwoben. Artes und Scientiae wissen das. Aber können sie es auch vermitteln?
Darum der Verdacht, dass es doch eine Träne der Trauer war. Denn zur Veranstaltung waren wesentlich mehr Stühle als Menschen erschienen. Weinten Artes deshalb?
Es ist ein zartes Pflänzchen, dieses kritische Denken. Und ein Dorn im Auge eines jeden Herrschaftssystem. Wer hinterfragt, geht immer ein Risiko ein. Ist die ETH vielleicht zu sehr zu einem Herrschaftssystem geworden, könnte man als Aussenstehender fragen?
Wir alle haben unsere Zeit auf diesem Planeten. Man kann sie als Geschenk ansehen. Oder als Bürde. Oder als Zufall. Sie hat einen Anfang und ein Ende. Wird man am Ende des Lebens einem Schöpfer gegenüberstehen, wie die heulenden Marienstatuen einen glauben machen wollen? Oder einer der Artes und einer der Scientiae? Oder dem Nichts?
Fragen wir uns am Ende auf dem Sterbebett, was wir alles erreicht haben? Oder was wir verpasst haben? Ziemlich sicher wird niemand sich danach erkundigen, wie viele ECTS-Punkte wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben.
Wohl aber könnte die Frage auftauchen: Mensch, warst du Mensch?
Und weil das ein viel zu poetischer Schluss ist, hier noch der Hinweis, dass die ETH zwei Millionen Insekten in ihrer entomologischen Sammlung zählt. Jetzt, da die Tiere auch als Nahrungsmittel zugelassen sind, könnte ein hungriger Doktorand beim durchschnittlichen Verzehr von 60 Insekten pro Tag immerhin 91 Jahre lang leben.
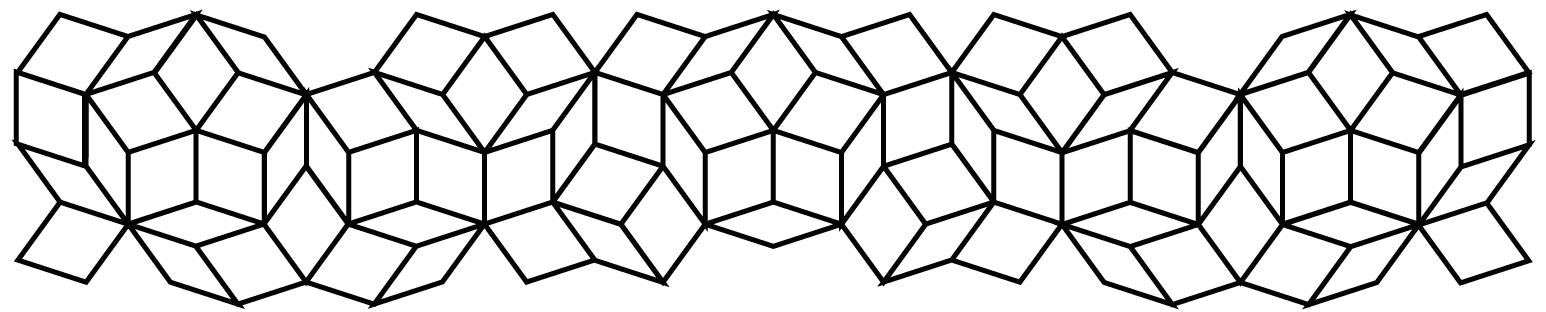
#8:
Die Jugend gehört gehört, nicht bestraft
In den vergangenen Wochen gingen Jugendliche in verschiedenen Schweizer Städten auf die Strasse. Auch auf der Polyterrasse haben sie sich versammelt. Sie protestierten dort für den Schutz des Klimas.
Als «Klima-Streik» wird die Bewegung bezeichnet. Die Öffentlichkeit hat unterschiedlich auf den protestierenden Nachwuchs reagiert: immer mucken die auf, fanden die einen. Toll, die haben es verstanden, im Gegensatz zu uns Erwachsenen, so die anderen. Irgendwo dazwischen stehen Herr und Frau Durchschnitt mit ihrer Haltung: Ja, die haben schon Recht, man müsste vermutlich langsam etwas tun. Wir sind auch gegen diese energiefressenden Kunstschnee-Kanonen, deshalb fliegen wir in den Sportferien lieber nach Thailand.
Im Vorfeld der Klimastreik-Kundgebungen fokussierte die mediale Berichterstattung aber nicht auf die Sorgen der Jugend und ihr Problem, auf einem sterbenden Planeten aufzuwachsen. Sondern darauf, dass die Demonstrierenden den Unterricht an ihren Schulen schwänzen. Der Kanton St. Gallen liess verlauten, dass er kein Pardon kenne. Wer protestiere, werde büssen. Andernorts gab man sich liberaler: Schülerinnen hätten ein Kontingent an frei verfügbaren Halbtagen, das sie, wenn sie nichts besseres zu tun hätten, auch wegdemonstrieren könnten. Die Zürcher Schulleiter gaben bekannt, dass sie aus Gründen der Gerechtigkeit einheitliche Strafen für alle diskutierten. Und im Nachhinein verteilte eine Schule in der Westschweiz allen Schülern die schlechteste Note, die wegen des Protests eine Prüfung verpasst hatten.
Halten wir fest: Junge Menschen gehen auf die Strasse, um gegen unseren Umgang mit der Umwelt zu demonstrieren. Sie haben dazu jedes erdenkliche Recht. Schliesslich werden sie um die drei Jahrzehnte länger leben als – beispielsweise – ich. Und etwa ein halbes Jahrhundert länger als viele Mitglieder von Regierungen und Parlamenten. Die Jugend verteidigt friedlich ihre künftigen Lebensgrundlagen. Doch der Rest spricht lieber darüber, wie man sie dafür am besten bestrafen kann.
Woher kommt sie bloss, die Liebe des Menschen zu Strafen? Kurt Tucholsky erfand einst in der «Weltbühne» eine fragmentarische Geschichte: die Wiedereinführung der Prügelstrafe durch den Reichstag zur Zeit der Weimarer Republik. Kurzfassung: Die Idee wird in den Raum geworfen. Zuerst geben sich linke und Demokraten entsetzt. Es folgen Lobgesänge der Traditionalisten auf den Nutzen körperlicher Züchtigung. Die Mitte kippt, nun wird über die Anzahl Hiebe und die Beschaffenheit der Schlagstöcke diskutiert. Der Verband der Stock-Hersteller lobbyiert. Am Ende schweigen die Sozialdemokraten, um sich von den Kommunisten abzugrenzen und das Gesetz passierte die Volkskammer unter Beifall. Jahre später wird allerdings moniert, dass Masochisten rechtsmissbräuchlich Bestrafung provozieren würden, um in den Genuss kostenloser Stockhiebe zu gelangen.
Der Parlamentarismus, so Tucholskys ihn karikiert, bringt selten grosse Würfe hervor. Auch neunzig Jahre später reden wir lieber davon, wie man aufmüpfige Schüler in die Schranken zu weisen hat. Statt darüber, wie deren legitimes Anliegen, die Zerstörung der künftigen Lebensgrundlagen des Menschen zu verhindern, auf der assembly line der Gesetzgebung verwässert werden.
Gleichzeitig wähnen wir uns im Glauben, dass die folgenden Generationen schon zur Vernunft kommen werden. Wie es bereits die Gegner des Frauenstimmrechts, die Hüter der Sexualmoral oder die Verteidiger der Sklaverei getan haben. Die Geschichte gab jeweils der anderen Seite Recht.
Aber vielleicht sind sie ja schon zur Vernunft gekommen. Und darum für unser Klima auf die Strasse gegangen. Und wenn man sie dafür bestraft, gewöhnen sie sie sich womöglich wieder ab, die Vernunft. Und das kritische Denken.
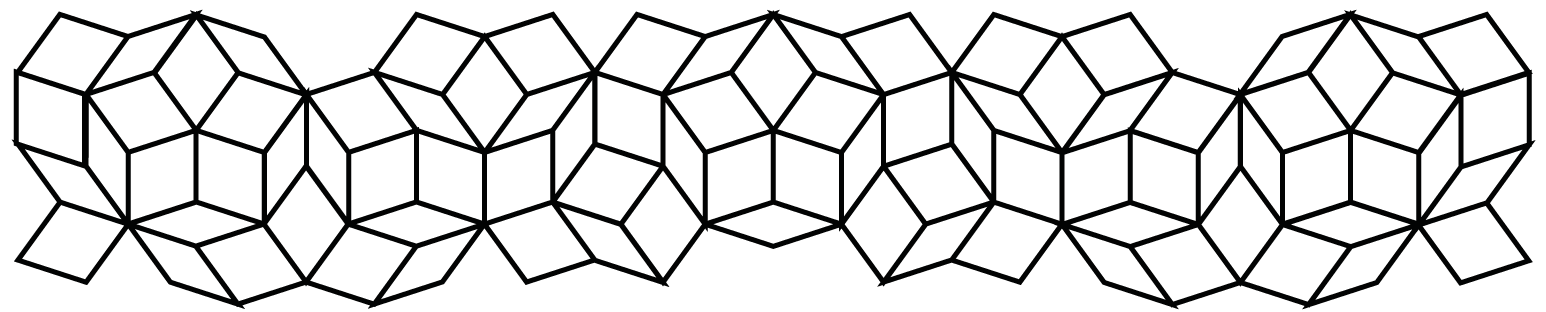
# 7:
Darwinsches aus der Pâtisserie
Eines der erstaunlichsten Objekte an der ETH liegt in keiner Sammlung, sondern an der Kaffeetheke im Hauptgebäude. Es handelt sich um ein Schweizer Süssgebäck, das Carac. Eine Mürbeteigschale mit cremiger Schokoladenfüllung und einem Zuckerguss. Meist deutet ein Schokoladepunkt in der Mitte diskret die Füllung an. Es gibt jedoch auch Exemplare ohne besagten Punkt.
Betrachtet man ein Carac von oben, erkennt man einen dünnen kreisrunden Mürbeteigrand, eine Glasur sowie einen schokoladefarbenen runden Punkt im Zentrum dieser Glasur. Das Carac lässt sich also sowohl an jeder mittig verlaufenden Achse spiegeln als auch am Kreismittelpunkt. Es hat weder einen Anfang noch ein Ende, als stünde es für die Ewigkeit
Diese krasse Symmetrie des Objekts wird durch seinen Namen unterstrichen. So ist das Wort Carac ein Palindrom, man kann es sowohl aus lateinischer als auch hebräischer Richtung lesen – eine relativ seltene Angelegenheit in der deutschen Sprache. Berühmte längere Palindrome sind etwa der weitgehend unbekannte bayrische Flurname Burggrub sowie der Leseesel. Auf die Entstehung letzterer Spezies warten wir seit vielen Jahren vergeblich, auch wenn ein gewisser Till Eulenspiegel standhaft behauptete, ein Exemplar gekannt zu haben. (An der Seriosität dieser Quelle darf gezweifelt werden.)
Bemerkenswert am Carac ist die Farbe seiner Glasur. Während die Füllung dunkelbraun ist – eine Ganache aus Schokolade und Rahm –, ist der Zuckerguss giftgrün. Das Grün hat allerdings keine Bedeutung. Es verweist weder auf Pfefferminz noch auf eine sonstwie mit der Farbe Grün in Verbindung stehende Geschmackrichtung. Es ist einfach.
Aber warum ist es? Und wieso hat das Carac überlebt, ja gar sein Territorium ausgeweitet, indem es längst in die Deutschschweiz eingewandert ist?
Die Erklärung auf diese Frage muss zwingend bei Charles Darwins Theorie zum Überleben der bestangepassten Spezies zu suchen sein. Das Carac, vermutlich in den 1920ern in der Westschweiz erstmals aufgetaucht, hat seinen stillen Siegeszug in erster Linie seiner Einfachheit zu verdanken. Die breite Masse will keine Extravaganz. Erfolgreiche Produkte bestechen durch die Wahl einiger weniger den Geschmack prägender Zutaten. Zweitens ist es die Auffälligkeit des Caracs, die es in der Auslage hervorstechen lässt. Seiner grünen Farbe macht höchstens noch die Schwedentorte Konkurrenz, allerdings auf gar plumpe Weise. Diese mehrschichtige, schmierige Ding, dessen trockene Biscuitmasse von plattgewalztem Marzipanteig mehr schlecht als recht zusammengehalten wird, kann mit der schlichten Eleganz und Standhaftigkeit eines Carac in keiner Weise mithalten.
Drittens ist es die Zeitlosigkeit des Carac, das es zu einem sprichwörtlichen Evergreen an der Ladentheke macht. Am ehesten lässt es sich optisch im Bauhaus verorten. Und das kommt ja irgendwie nie aus der Mode, ganz im Gegensatz zur gähnend langweiligen Verspieltheit des Jugendstils, dem etwa das Eclair zuzuordnen ist, mit seinen geschwungenen Linien.
Viertens ist die Haltbarkeit des Caracs zu loben. Während Erdbeertörtchen selbst unter einer Aspikschicht schon in wenigen Stunden ins Unappetitliche kippen, hält sich das Carac problemlos ein paar Tage. Einem Carac sieht man nicht an, ob es von gestern ist, was seine Wirtschaftlichkeit für den Verkäufer erhöht. Allerdings sollte man es angesichts des hohen Rahmgehalts nicht übertreiben.
Fünftens ist das Carac ein vergleichsweise günstiges Produkt. Der Autor dieser Zeilen hat vor wenigen Jahren in einer kleinen Backstube in der Berner Altstadt ein Carac für sage und schreibe 1.60 Franken erstanden. Und selbst die notorisch überteuerte in Zürich ansässige Confiserie Sprüngli verkauft ihre Caracs für bescheidene 3.50 Franken.
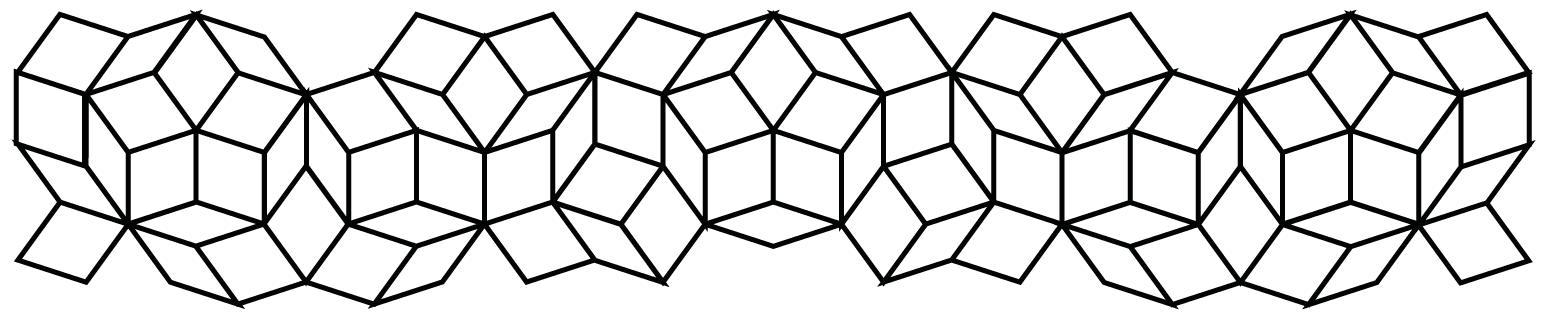
# 6:
Wir werden nicht so richtig warm mit den Fakten
Wir leben in einer spannenden Zeit. Je häufiger eine Wahrheit wiederholt wird, desto eher läuft sie Gefahr, als fake news auf dem Scheiterhaufen der überholten Meinungen zu landen. Nehmen wir den sprichwörtlichen elephant in the room, die Klimaerwärmung. Sie hat diesen Sommer wieder zu reden gegeben, weil die Leute geschwitzt haben. Und zwar dort, wo sie normalerweise nicht schwitzen. Also nicht nur unter den Achseln und zwischen den Pobacken, sondern auch im Büro und daheim.
Während Mitteleuropa also aus allen Ritzen trieft, versteht man in den Country Clubs Südfloridas beim besten Willen nicht, was das Gerede vom warmen Klima soll. Dort herrschen immer angenehme minus zehn Grad. Und während die Herrschaften in ihren Hummerkaltschalen stochern, sprechen sie den Polargletschern die Eigenschaft ab, vor sich hin zu schmelzen. Überhaupt, die Wissenschaft ist ja fast so schlimm wie der Journalismus, alles Lüge. Darauf nehmen wir noch einen.
Nun, wir wissen aufgrund etlicher Zahlenvergleiche: Generell sinkt die Wirtschaftsleistung eines Landes mit zunehmender Durchschnittstemperatur. Gleichzeitig steigt die Korruption, je heisser, desto bakshish, wie wir Araber sagen. Wenn das mit der Hitze so weitergeht, herrschen in Zürich bald Zustände wie in Sizilien. Allerdings stimmt das alles so nicht. Denn wenn die Menschen in heissen Ländern wirklich fauler wären, müsste Singapur, der Stadtstaat am Äquator, ein paar der miesesten Universitäten der Welt aufweisen. Und nicht zwei unter den Top 20.
Aber wir können die Fakten nicht ganz wegreden: Irgendein Arbeitspsychologe sagte vor zwölf Jahren gegenüber einer deutschen Zeitung, dass die Arbeitsleistung um 30 Prozent sinke, wenn ein Angestellter statt bei 23 bei 30 Grad Celsius tätig sei. Das ist im doppelten Sinne schlimm, denn einerseits hat wohl nie jemand diese Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft, andererseits wird sie seither immer zitiert, wenn das Sommerloch mit den Hundstagen zusammentrifft. Aber ob sie nun stimmt oder nicht, ist nicht so wichtig. Denn eine Studie der University of East London hat bewiesen, dass die der Hitze wegen um 30 Prozent gesunkene Produktivität wieder um 14 Prozent steigt, wenn man nur genügend trinkt. Auch darauf nehmen wir noch einen.
Alles halb so schlimm mit dieser Klimaerwärmung. Überhaupt ist nicht einfach nur das Klima an sich wichtig für die Leistungen eines Arbeitnehmers. Sondern das Arbeitsklima. Und das erwärmt sich ausgerechnet diametral zur körperlichen Reibung des Vorgesetzten an seinen Mitarbeitenden. Ein Phänomen, das übrigens noch nicht zu Ende erforscht ist.
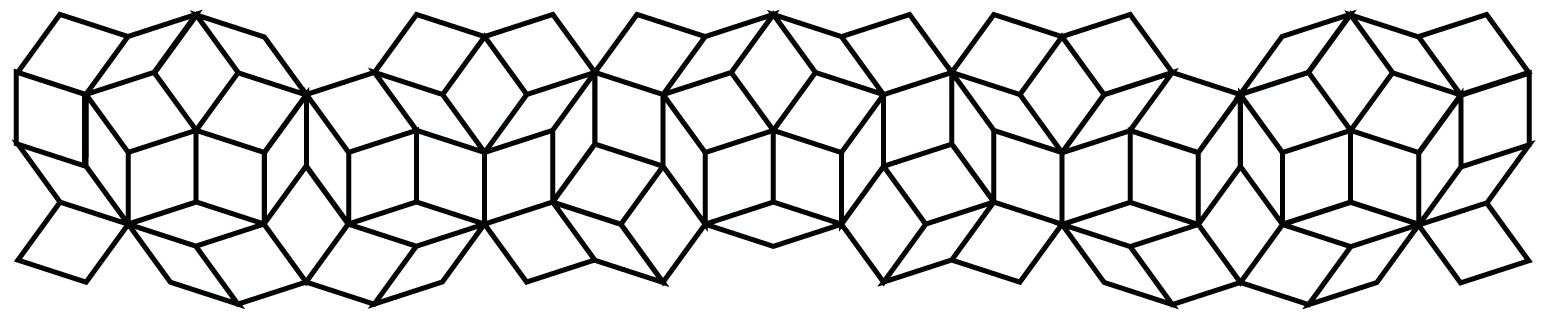
# 5:
Studien zeigen: Glossen haben nicht immer recht
Gemäss der Studie einer Forscherin an der Universität Wien wirken Männer, die komplexe Musik auf ihrer iTunes-Playlist haben, auf Frauen attraktiver. Das ist umso bemerkenswerter, als erst kürzlich bekannt wurde, dass Frauen während der fruchtbaren Tage ihres Reproduktionszyklus' Musik von Komponisten komplexer Stücke bevorzugen, während sie bei One-Night-Stands lieber Typen mit doofer Musik auf dem Handy vögeln. Eine andere Studie konnte belegen, dass Frauen von allen Körperteilen des Mannes in der Regel der Attraktivität des Oberkörpers am meisten Gewicht beimessen.
Diese Erkenntnisse sind in etwa so wertvoll wie die Hypothese in Loriots Film «Ödipussi», wonach sein Kunde, Herr Melzer, auf einer violetten Couch möglicherweise seine Gattin umbringt, es sei denn, die Couch ist geblümt.
Fast täglich tropft unnütze Wissenschaft via Gratiszeitungen auf uns Menschheit ein. Das ist ärgerlich. Aber Studien belegen, dass Gratiszeitungen vor allem deshalb so beliebt sind, weil sie gratis sind. Das wiederum dient als Beleg für den Homo oeconomicus, zu dem es übrigens diverse Studien gibt, die seine Existenz negieren.
Es ist die noble Aufgabe der Wissenschaft, der Gesellschaft zu erklären, was sie den ganzen Tag tut. Bloss landen nicht immer die richtigen Beispiele aus der Forschung im medialen Einheitsbrei. Auch die Politik, der verlängerte Arm der Gratiszeitungen, zitiert fröhlich aus allerlei echten und erfundenen Studien. Wenn Parlamentarier und -innen jedes Mal, wenn sie irgendeine Studie zitieren, in Afrika ein Kind füttern müssten, wäre das Problem des Welthungers längst gelöst. Das hat neulich eine Studie ergeben.
Seit wissenschaftliche Publikationen tiefer Güteklassen wie Bärlauch im Frühling aus dem Boden schiessen, scheint es kein Halten mehr zu geben. Jede noch so dümmliche Bachelorarbeit schafft es vielleicht, in Form eines einspaltigen Artikels die Gemüter zugfahrender Homini oeconomici zu erfreuen.
Studien haben ergeben, dass Menschen weniger Gratiszeitungen lesen, wenn sie mit dem Auto zur Arbeit fahren. Ich bin dafür, mehr Geld in den Bau von Strassen und Parkplätzen zu investieren. Studien zeigen, dass das auch die Wirtschaft ankurbelt.
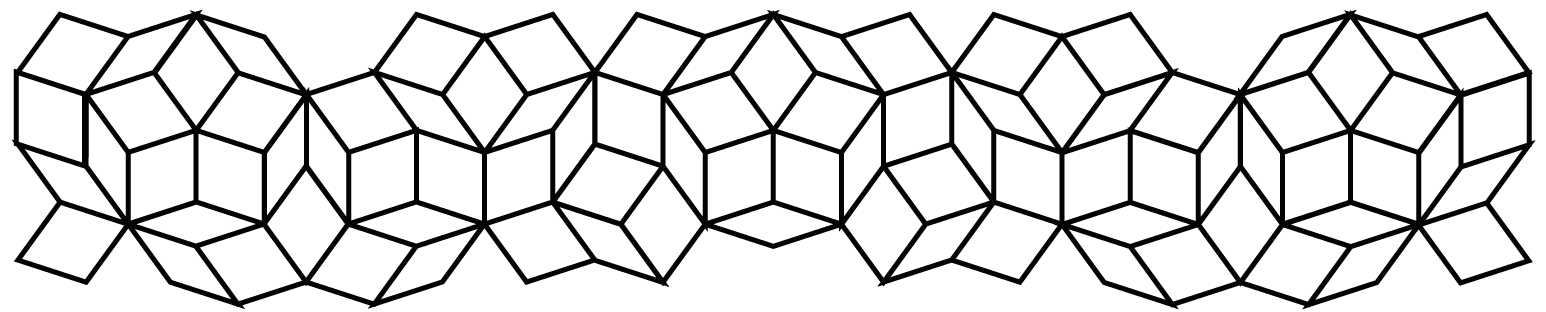
# 4: Der Roboter, der mir meinen Platz wegnimmt
Es vergeht keine Woche, in der man nicht im Altpapier von Robotern lesen kann, die uns alle ersetzen werden. Mittlerweile existieren sogar sehr genaue Zahlen dazu. Jede Maschine, die irgendeinen Arbeitsvorgang übernimmt, stellt soundso viele Mitarbeitende auf die Strasse. Blitzgescheite Forscher arbeiten unentwegt an der Fortentwicklung der künstlichen Intelligenz, während der Rest der Menschheit die reale Dummheit praktiziert. Zumindest dieser Eindruck entsteht, wenn man in den Zeitungen nicht nur die Wissenschafts-, sondern auch die Weltpolitik-Seiten liest.
Institute wie die ETH werden sich in absehbarer Zeit mit Sammelklagen von Gewerkschaften konfrontiert sehen. Dann nämlich, wenn die Arbeiterbewegung bemerkt, dass die Roboterbewegung nicht einfach so zu existieren begonnen hat, sondern gezielt entwickelt worden ist. Das wird teuer. Letztlich werden ETHs, MITs etc. gerichtlich dazu verpflichtet werden, dem überflüssig gewordenen Rest der Menschheit ein bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Um diese Unsummen aufzubringen, wird die ETH künftig riesige Serien von Tellerwäscher-Robotern entwickeln. Die wiederum werden sich eines Tages zu Millionärs-Robotern hocharbeiten. Und dann haben wir den Salat.
Allerdings hege ich den einen oder anderen Zweifel, ob sich das alles genau so abspielen wird. Denn das Problem scheint mir, dass die meisten Roboter noch immer saudumm sind. Sie sind ziemlich beschränkt in ihren Fähigkeiten.
Mit anderen Worten, es besteht derzeit eine Roboter-Generation, die im Grunde Leute wie mich längst ersetzt hat. Also Menschen, die überwiegend talentfrei, minder intelligent und obendrein stinkfaul sind. Wir, also diese Leute, hätten unseren Platz in der Gesellschaft längst an die doofen Maschinen abtreten müssen.
Aber die Verdrängung ist nicht eingetreten, obwohl wir bei ebenso geringer Leistung deutlich mehr Bedürfnisse haben als unsere automatisierten Kollegen. Es gibt keine Reality-TV-Shows, in der Roboter sich gegenseitig an die Kehle gehen. Keine Roboter-Punks, die mit ihren Roboterhunden die Ecke beim Hauptbahnhof bevölkern. Und keine Roboter, die in Friseursalons stupide Gesellschaftsmagazine mit emotionalen Bildlegenden konsumieren.
Allerdings soll vor einigen Tagen so ein Gerät im Büro der Critical-Thinking-Leute gesessen und sich als neuer Kolumnist beworben haben. Ganz entspannt bin ich in dieser Frage eben doch nicht.
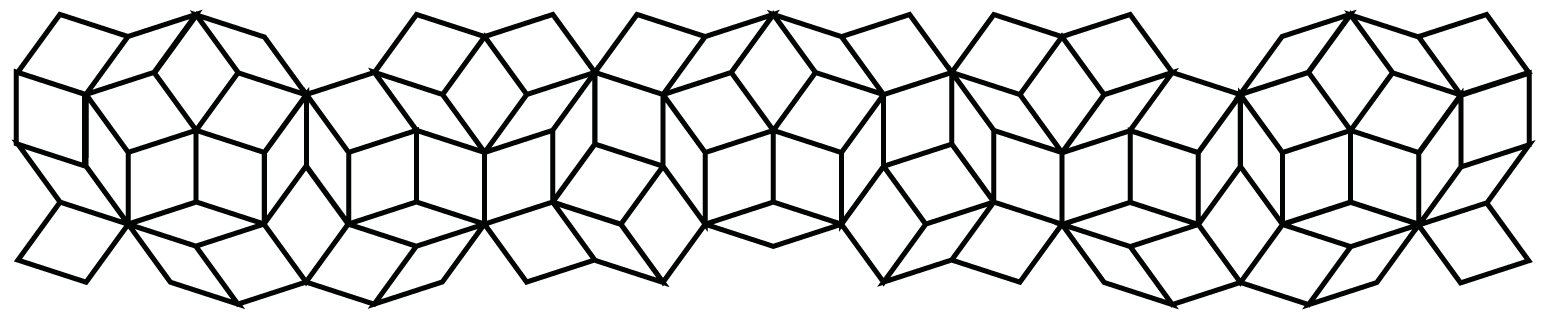
# 3: Wer geht ab?
Ich hätte mich gerne mit Nadezda der jungen russischen Studentin unterhalten. Doch ich war zu spät dran. Fast 150 Jahre zu spät, denn Nadezda schrieb sich 1870 an der ETH ein. Sie war die erste Studentin, also der erste Mensch weiblichen Geschlechts, der, also die an der ETH studierte. Einen Abschluss als Ingenieurin erlangte sie offenbar nicht, zumindest nicht an dieser Schule. Ich erachte es als sehr wahrscheinlich, dass seit Nadezdas Studienbeginn nie eine Frau ein Studium an der ETH abgeschlossen hat. Zur Untermauerung meiner These zitiere ich ein Heft, das mir neulich in die Hände gelangt ist. Es trägt den fröhlichen Titel «Jobjournal». Darunter steht geschrieben: «Stellenanzeiger exklusiv für ETH Abgänger». Mal abgesehen davon, dass ich den Drang verspüre, mit meinem Kuli einen Bindestrich zwischen die Abkürzung «ETH» und das Wort «Abgänger» zu setzen – wo sind die AbgängerInnen? Sind sie abgegangen, bevor sie so richtig abgehen konnten, wie Nadezda?
Der Anteil Frauen an den neuen Studierenden betrug im Jahr 2015 immerhin einen Drittel. Es kann doch nicht sein, dass die alle heiraten und schwanger werden, bevor sie ihre Bachelors und Masters machen können?
Allerdings tu ich der Schule wahrscheinlich Unrecht. Besagtes Heft wurde nicht von ihr direkt ausgegeben, sondern von ihrer Alumni-Vereinigung. Und im Gegensatz zur ETH, die sich als Bundesbetrieb an die von der Schweizerischen Bundeskanzlei erarbeiteten Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren halten muss, beziehungsweise sollte, können die Alumni als privater Verein natürlich so viele Frauen vernachlässigen, wie sie möchten. Schliesslich steht auf diesen Tatbestand bislang keine Strafe, weswegen es bereits vermessen ist, überhaupt von einem Tatbestand zu sprechen. Womöglich handelt es sich hierbei eher um eine Unterlassungssünde. Und Sünden werden ja mittlerweile auch nicht mehr mit dem Gang in die Hölle bestraft, der Vatikan hat diesen Ort klammheimlich abgeschafft, und zwar rückwirkend. Wer also im Mittelalter in die Hölle wanderte, wurde post mortem und rückwirkend ins Fegefeuer transferiert. Und dort, im Fegefeuer, zumindest dem sprachlichen, tummeln sich auch die Alumni und Alumnae, die für diesen Unsinn verantwortlich sind.
Worum es sich bei dieser Formulierung auch immer handeln mag, für eine Gruppe von Menschen, die sich nicht ganz zu Unrecht für besonders klug halten, ist es eine grosse Dummheit, allein den Abgängern die Bühne zu überlassen. Abgängerinnen möchten sicher auch nicht ungern Karriere machen. Auch wenn sie nicht so viele sind. Und auch wenn sie durch Babypausen und derlei dann und wann an gradlinigen Laufbahnen gehindert werden. Und auch wenn sie ausser einigen Professorinnen, einer Rektorin, diversen Bundesrätinnen, Präsidentinnen und Premierministerinnen anderer Länder nicht ganz so viele Vorbilder haben wie ihre männlichen Kollegen. Vielleicht werden auch sie eines Tages als Abgängerinnen sichtbar, etwa auf der Titelseite einer der kommenden Ausgaben besagten Hefts.
Übrigens taucht dann doch noch eine Frau auf. Auf Seite 2, auf einem Foto, das eine Anzeige einer Firma namens «Open Systems» ziert. Die Frau auf dem Bild trägt weder Schuhe und Socken, eine legère weisse Baumwollhose, ein Hemd, das ihren Konturen schmeichelt. Und sie frisiert lasziv ihr langes blondes Haar. Dabei sitzt sie auf einem Outdoor-Sofa, das auf einer Dachterrasse steht. Darunter steht etwas über «Mission Control Security Services im Bereich IT-Sicherheit». Und einmal mehr möchte man grosszügig Bindestriche verteilen. Wahrscheinlich will sich die junge Dame aus Gründen der IT-Sicherheit gerade einen Pferdeschwanz binden, so etwa sieht das aus.
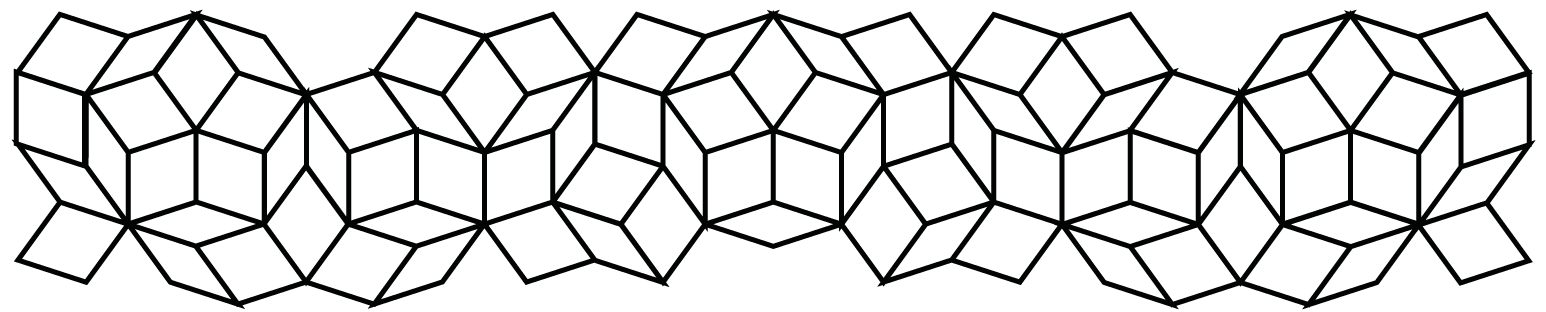
# 2: Über wenig beschrittene Wege und damit verbundene Chancen und Risiken
Neulich sass ich auf der Terrasse vor dem ETH-Hauptgebäude und gegen meinen eigenen Willen rezitierte ich in Gedanken ein Gedicht. Ich hatte es etwas zu oft gelesen. Deshalb krallte es sich in meinem Kopf fest und trat nun zu allen möglichen Unzeiten auf die hell erleuchtete Bühne meiner Gedanken.
Gedichte haben an Bedeutung eingebüsst. Früher vermochten sie Herzen zu entflammen und Kriege auszulösen. Heute weiss ich von niemandem, der bei Amazon neu erschienene Gedichtbände auf seinen E-Reader lädt. Vielleicht sind einfach alle guten Gedichte bereits gedichtet? Die Quelle der Lyrik versiegt? Oder es ist reine Ökonomie. Das Desinteresse des Konsumenten hat einen Markt zum Verschwinden gebracht.
Naturwissenschaftlich interessierte Menschen scheinen die Sprache oft im besten Fall als Werkzeug zu verstehen. Als eines, das Präzision schafft, aber bestimmt nicht Schönheit. Man hängt die Sprache zurück an den Nagel, wenn man mit ihr fertig ist. Aber damit dichten? Iwo.
Dabei ist keine andere Form der Literatur derart von Formalem geprägt, wie die Lyrik. Sie folgt traditionellerweise metrischen Regeln, setzt auf Alliterationen und Reimmuster, ihre Zeilen nehmen eine physische Existenz an, in Abschnitten, manche davon - dem Versmass geschuldet – eingerückt. Hinter vielen Gedichten steckt eine komplexe Struktur, eisern folgen sie bestimmten Regeln, denen sie sich selber unterworfen haben. Müsste dieser Umstand Gedichte nicht auch für Mathematiker interessant machen?
Neben dem Formalen, das einen Teil ihrer Attraktivität ausmacht, interessiert natürlich der Inhalt. Manche Poesie erschliesst sich der Leserin nicht auf Anhieb – oder gar nie. Andere verstehen selbst notorisch Desinteressierte auf Anhieb. Wieder triffts mitten ins Herz.
Das Gedicht, das sich mir da selbst rezitierte, stammt vom Amerikaner Robert Frost. Mit ihm fühle ich mich vielleicht deshalb besonders verbunden, weil er denselben Geburtstag hat wie ich. Einfach rund ein Jahrhundert früher. Frost ist so etwas wie der Landschaftsmaler der amerikanischen Lyrik des 20. Jahrhunderts. In «The Road Not Taken» – ebendiesem Text, der nicht aus meinem Kopf will – beschreibt er eine Wanderung im Wald. Der Wanderer muss sich an einer Gabelung zwischen zwei Strassen entscheiden. Zuerst bemerkt er, dass er als ein Reisender nicht zwei Wege gleichzeitig nehmen kann. Er stellt damit quasi die Unteilbarkeit der Menge «ein Mensch» fest. Sodann wägt er ab, welche der beiden Strassen er nun beschreiten soll, wobei er gewahr wird, dass sie sich nicht sonderlich voneinander unterscheiden. Interessanterweise taucht zu keinem Zeitpunkt in seinen Gedanken ein Ziel auf, das er zu erreichen sucht. Der Wanderer entscheidet sich schliesslich für einen Weg und resümiert erst nach einer Weile, dass es sich dabei um die weniger bereiste Strasse gehandelt habe. Dieser Umstand, nämlich dass er denjenigen Weg genommen habe, den vor ihm weniger Menschen beschritten hätten, ebendieser Umstand habe den entscheidenden Unterschied gemacht («this has made all the difference»).
Wir sind geneigt, Robert Frost vollumfänglich zuzustimmen. Nicht das, was alle machen, führt zu etwas Neuem. Erst wer sich traut, einen anderen Weg zu beschreiten als alle vor ihm, wird möglicherweise für seinen Mut belohnt. Tolle Erkenntnis. Und so wahr.
Allerdings vergessen wir dabei, dass sich die Strassen in Frosts Gedicht ja an und für sich nicht sonderlich von einander unterschieden haben. Die Überzeugung, den weniger bereisten Weg gewählt zu haben, formiert sich im Kopf des Reisenden erst, nachdem er seine Entscheidung gefällt hat. Er hat damit im Nachhinein einen Bauchentscheid zu rationalisieren versucht. Und ihn im selben Atemzug zum Schicksalsmoment erhoben.
PS: Robert Frost soll das Gedicht bloss als Witz und Anspielung an einen Wanderfreund geschrieben haben, der sich an Weggabelungen nie für eine Richtung entscheiden konnte. Doch was kann ein Autor dafür, wenn seine Leserinnen den Schmarrn, den er niederkritzelt, für grosse Wahrheiten halten?
PPS: Ein Bekannter von mir entschied sich während der von ihm gehassten Fastnachtszeit einmal, nicht den üblichen Weg durchs Niederdorf zu nehmen, sondern stattdessen den weniger oft beschrittenen via Obere Zäune. Dort wurde er dann von zwei jungen Männern ausgeraubt.
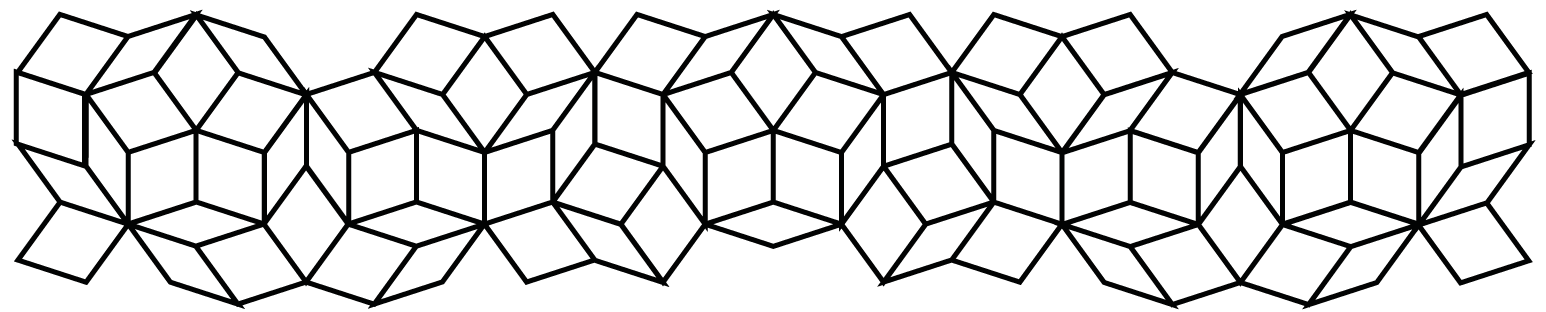
# 1: Der Mythos
Von den fünf Türen, die theoretisch an der halbrunden Fassade des ETH-Hauptgebäudes ins Innere führen, ist nur eine geöffnet. Nur hier, will einem das Gebäude sagen, darfst du hinein. Der Weg ist vorgegeben. Kein Raum für Spielerei, für Individualität. Der Erbauer hatte sich das vermutlich anders vorgestellt. Aber was verstand der schon von Betriebskonzepten und Heizperioden? Nein, wer durch den Haupteingang hinein will, hat die Mitte zu wählen. Manchmal steht gar ein uniformierter Mensch daneben, als ob er sicherstellen wollen würde, dass wirklich niemand einen alternativen Zugang ausprobiert.
Das Innere des Gebäudes passt zur Marke ETH. Kein Pomp begrüsst hier den Besucher. Nüchternheit, Understatement. Ein grauer Korridor, eine Kaffeestation. Ein paar Stühle und Tische, an denen Menschen mit enorm wichtigen Dingen beschäftigt sind. Die Stille hat ein Echo. Sieht so das Foyer einer der bedeutendsten Hochschulen der Welt aus?
Obacht: Wer jetzt geradeaus weitergeht, durchquert das Gebäudeinnere und landet am Ende seines Wegs auf der Polyterrasse. Merke: Wer nicht aufpasst, ist schnell wieder raus. Was für ein Gegensatz zur Universität nebenan! Die zwingt sofort zur Wahl, kaum hat man das Gebäude betreten. Links oder rechts? Rauf oder runter? Nicht so die ETH. Hier kann man einfach durchflutschen. Wer mehr von dieser Schule will, scheint sie zu sagen, muss etwas dafür tun.
ETH. Das Traumziel aller mathematisch-naturwissenschaftlich begabten Gymnasiasten. Und eine Abschreckung für alle, denen mathematisch-naturwissenschaftlich begabte Gymnasiasten nicht ganz geheuer sind. Republic of Nerds. Aber auch eine Eliteschule, auf die die ganze Welt schielt. Und ein Ort, der gnadenlos siebt und schon so manchen vermeintlich hoffnungsvollen Nachwuchswissenschaftler ungenügender Leistungen wegen wieder ausgespuckt hat.
Ein ETH-Abschluss ist ein Garant für einen gut bezahlten Job und eine Karriere mit Aufstiegsmöglichkeiten. Ausser vielleicht im Falle der Architekten, die den Zusatz «ETH» mit besonderem Stolz im Titel tragen – einerseits, um sich gegen die Kollegen von den Fachhochschulen abzugrenzen - andererseits als Kompensation für ihre abschreckend tiefen Gehälter. Etwas besser verdienen die Apotheker, allerdings verbringt so mancher von ihnen seine Tage im Laden stehend, Tagescrèmes und Kräutertees verkaufend und mit ernster Miene Rezepte visierend.
Meine Mission: Diese Schule und ihre Menschen verstehen. Und nicht daran scheitern.
