«Die Ukraine braucht einen nationalen Dialog»
Nach Wochen der Konfrontation sucht die Ukraine nach einer politischen Zukunft. Der Konflikt zwischen der neuen Regierung in Kiew und Russland zugewandten Kräften spitzt sich insbesondere auf der Krim zu. Trotzdem glaubt Russland-Experte Jonas Grätz, Wissenschaftler am Center for Security Studies, nicht an eine Rückkehr des Kalten Kriegs.
ETH-News: Herr Grätz, ist mit der Flucht des Präsidenten Janukowitsch vom Sonntag der wichtigste Schritt für den Frieden in der Ukraine gemacht?
Jonas Grätz: Sehr viele Menschen in der Ukraine sehen die Geschehnisse nach wie vor als Putsch. Im russischen Fernsehen, das besonders im Südosten des Landes geschaut wird, werden die neuen Autoritäten als Faschisten und Neonazis dargestellt. Eine neugewählte Regierung wird es sehr schwer haben, im gesamten Land Anerkennung zu finden.

Könnte Russland in der Ukraine militärisch eingreifen?
Direktes militärisches Eingreifen halte ich für unwahrscheinlich. Es ist auch gar nicht nötig, denn für eine Einflussnahme hat Russland andere Mittel.
Welche?
Auf der Halbinsel Krim, einer zur Ukraine gehörenden autonomen Region, geniesst Russland sehr viel Unterstützung. Es könnte dort eine Unabhängigkeitserklärung von separatistischen Kräften unterstützen. Am Donnerstagmorgen haben bewaffnete pro-russische Kräfte bereits das Gebietsparlament der Krim besetzt. Russland hat jedoch der Ukraine 1994 im Budapest-Memorandum – einem internationalen Vertrag mit Grossbritannien und den USA – die territoriale Integrität zugesichert. Es wird deshalb entscheidend sein, ob es gelingt, die separatistischen Kräfte zur Akzeptanz einer neuen Regierung in Kiew zu bewegen. Zum Beispiel durch weitergehende Autonomierechte.
In der Westukraine kämpfen die Menschen für das Assoziierungsabkommen mit der EU. Im Südosten werden ukrainische Flaggen durch russische ersetzt. Erleben wir gerade eine Rückkehr des Kalten Kriegs?
Russland hat sich in den letzten Jahren stärker vom Westen abgegrenzt, unter anderem durch einen Rückgriff auf sowjetische Symbole. Aber die Revolte in der Ukraine zeigt ja gerade, dass diese Spielchen des Kalten Krieges beim Volk nicht mehr ziehen. Die Bürger sind heute weiter; sie nehmen ihre Geschicke selbst in die Hand. Was letztendlich zum Aufstand geführt hat, war der Wille der Demonstranten zum Wandel. Da konnte weder die EU noch Russland viel dafür oder dagegen ausrichten. Ich würde die geopolitische Machtkonkurrenz in diesem Fall deshalb nicht zu hoch bewerten. Auch auf der Krim gibt es etwa die Krimtataren, die sich für die neue Regierung ausgesprochen haben. Man muss die Lage dort allerdings jetzt genau beobachten.
Der russische Präsident Putin hat im Jahr 2000 als Gegenmodell zur EU eine Zollunion initiiert, die im nächsten Jahr zur «Eurasischen Wirtschaftsunion» ausgebaut werden soll. Damit werden ehemals sowjetische Staaten näher an Moskau gebunden. Ist das für einen Teil der Ukrainer eine Alternative zur EU?
Die Ukrainer werden in Moskau als slawisches Brudervolk der Russen angesehen. Zudem hat Kiew auch symbolische Bedeutung als Ursprung des russischen Staatswesens. Das ist bei derzeitigen Unionsmitgliedern wie Kasachstan, Kirgistan oder Tadschikistan nicht der Fall. Ein Beitritt der Ukraine wäre für den Bund essentiell. Doch davor hat selbst Janukowitsch abgesehen, weil dies ein zu starkes politisches Symbol gewesen wäre. Zwar sind die östlichen Gebiete der Ukraine sehr stark von der russischen Wirtschaft abhängig. Dort treten viele Bürger für eine Zollunion mit Russland ein. Doch als identitätsstiftendes Projekt wurde die eurasische Union in der Ukraine nie angesehen.
Inwiefern spielt Russland seine wirtschaftliche Macht gegenüber der Ukraine heute bereits aus?
Russland hat seine Wirtschaftshilfe von 15 Milliarden Euro, die es Janukowitsch zugesprochen hatte, sistiert. Zudem wird mit Wirtschaftssanktionen gedroht, wenn die Ukraine ein Freihandelsabkommen mit der EU unterzeichnet. Nun haben jedoch mehrere Finanzminister der EU angekündigt, dass sie in die Bresche springen und diese Gelder schnell und unbürokratisch zur Verfügung stellen werden. Das soll die Basis für einen nationalen Dialog schaffen.
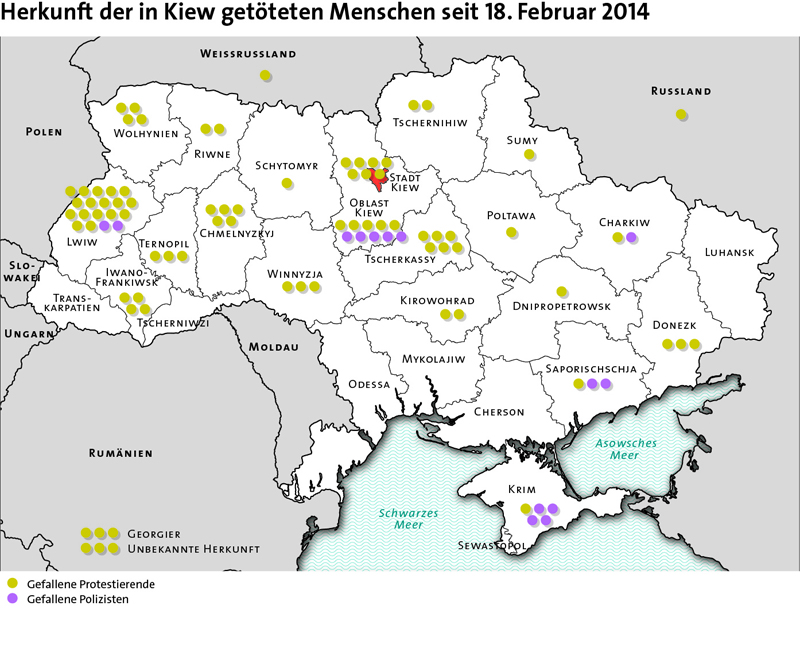
Ein klares Signal, oder?
Es zeigt, dass die EU den Machtwechsel als legitim erachtet. Und natürlich glaubt man, mit den neuen Akteuren besser zusammenarbeiten zu können, als mit Janukowitsch, der immer hin und her laviert ist zwischen der EU und Russland.
Wie stark wird die Ukraine auch bei einer weiteren Annäherung an die EU von Russland abhängig bleiben?
Kein Präsident in Kiew kommt an Russland vorbei. Ein Drittel der Exporte gehen in die von Moskau dominierte Zollunion. 60 Prozent des ukrainischen Erdgases wird aus Russland importiert. Damit hat Russland ein mächtiges Druckmittel zur Hand. Zudem gewährte Russland Janukowitsch als Gegenleistung für dessen Kremltreue vergünstigte Gaspreise. Diese Verträge laufen Ende März ab und müssen neu verhandelt werden. Höhere Gaspreise sind jedoch das letzte, was die Ukraine derzeit brauchen könnte.
Gibt es Alternativen?
Ja, der ukrainische Staat hat in den letzten Jahren mehrere Abkommen mit Shell und Chevron für die Erdgasförderung im eigenen Land abgeschlossen. Das könnte in Zukunft noch forciert werden. Im Schwarzen Meer gibt es vor der Krim zusätzliche Vorkommen, die in Zukunft gefördert werden sollen. Auch Kohlevorkommen im Land könnten zu mehr Energieautarkie beitragen. Und bei Preissteigerungen seitens Russland wäre auch ein Gasimport aus der EU denkbar.
Was braucht die Ukraine nun am dringendsten?
Das Land braucht vor allem einen nationalen Dialog zwischen den neuen Kräften in Kiew, den Bürgern im Westen und den östlichen Regionen des Landes. Man muss jetzt um eine gemeinsame Interpretation der Ereignisse der vergangenen Monate ringen. Internationale Organisationen wie die OSZE könnten dabei eine wichtige Rolle spielen, wenn es ihnen gelingt, das Vertrauen der Parteien zu gewinnen. Die Ukraine steht wirtschaftlich am Abgrund. Das Land braucht daher rasch eine effektive Regierung, die die eklatanten Probleme des Landes löst.
Jonas Grätz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des «Global Security Team» am Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich. Er hat sich auf Fragen der Energiesicherheit sowie russische Innen- und Aussenpolitik spezialisiert.
Schweizer als OSZE-Botschafter in der Ukraine
Am 24. Februar hat Bundespräsident Didier Burkhalter, derzeit Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), den Botschafter Tim Guldimann zu seinem persönlichen Gesandten für die Ukraine ernannt. Guldimann spricht Russisch und verfügt als ehemaliger Leiter der OSZE-Unterstützungsgruppe in Tschetschenien (1996-1997), der OSZE-Mission in Kroatien (1997-1999) und der OSZE-Mission in Kosovo sowie als Sonderbeauftragter des UNO-Generalsekretärs im Kosovo (2007-2008) über grosse Erfahrung im Bereich der Konfliktbearbeitung in Osteuropa sowie gute OSZE-Kenntnisse. Guldimann bleibt zugleich Leiter der Schweizer Botschaft in Berlin.

Kommentare
Noch keine Kommentare