«Mit diesem Szenario hat kaum jemand gerechnet»
Die COVID-19 Pandemie stellt das Schweizer Krisenmanagement auf eine harte Probe. Wie gut die Schweiz die Krise in der ersten Phase meisterte, hat ETH-Professor Andreas Wenger mit seinem Team vom Center for Security Studies im Detail untersucht.
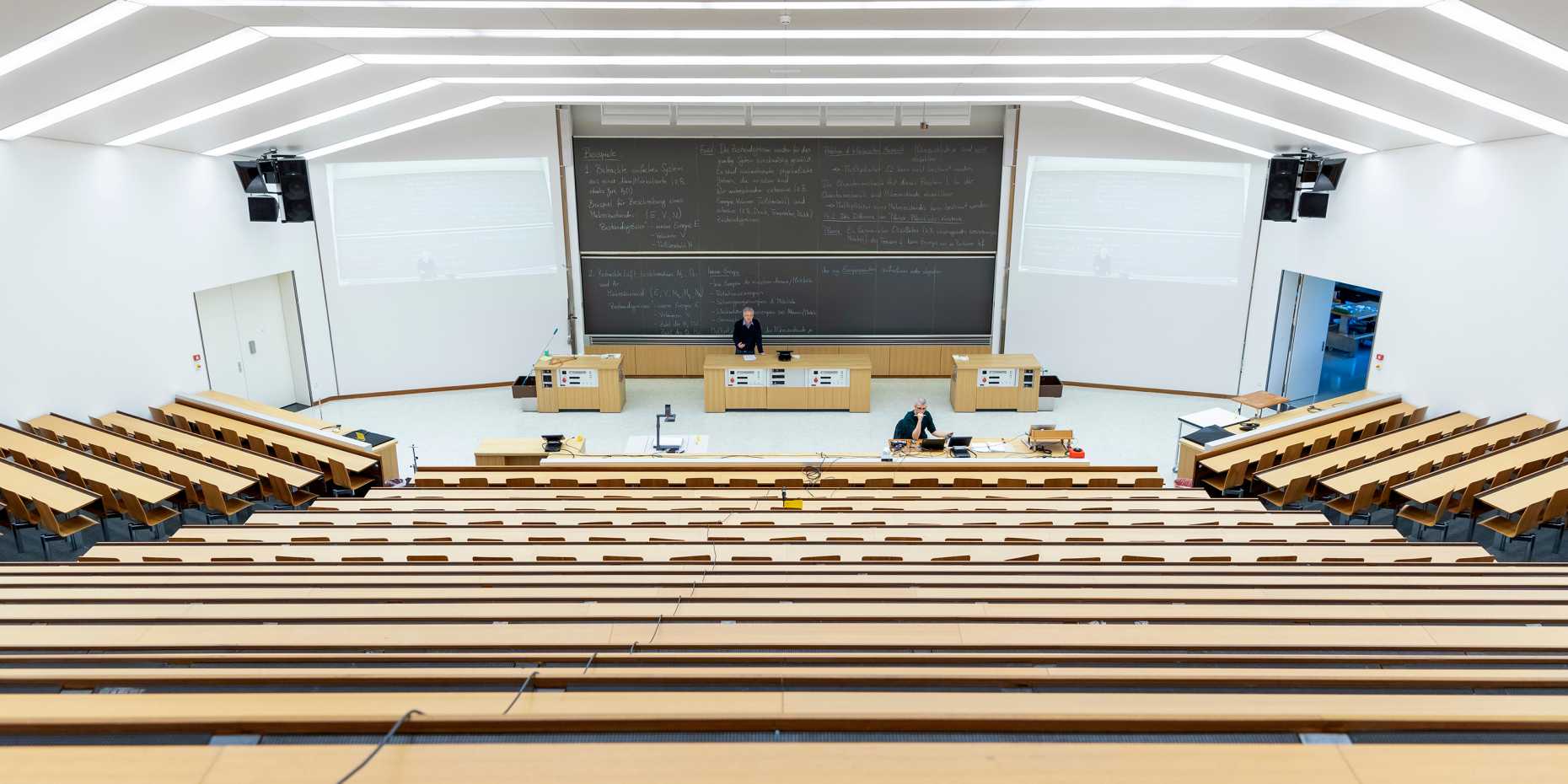
ETH-News: Herr Wenger, das Bulletin 2020 zur schweizerischen Sicherheitspolitik des Center for Security Studies (CSS) steht ganz im Zeichen der Corona-Krise. Was haben Sie untersucht?
Andreas Wenger: Wir befassen uns seit vielen Jahren mit dem Thema Krisenmanagement. Die Corona-Krise ist nicht nur eine grosse gesellschaftliche Herausforderung, sondern auch ein wissenschaftlich interessantes Fallbeispiel. In einer laufenden Pandemie das Krisenmanagement zu studieren, ist allerdings nicht einfach. Deshalb haben wir uns auf die Vorbereitung auf Pandemien und die erste Welle im Frühjahr konzentriert.
Auf welche Informationen stützen Sie sich?
Neben historischen Materialien studierten wir die Protokolle der Krisenstäbe und führten eine Reihe von Experteninterviews. Zur Einordnung haben wir dann auf etablierte Erkenntnisse aus der Krisen- und Katastrophenforschung zurückgegriffen.
Was hat Sie am meisten überrascht?
Diese Frage haben wir den Experten auch gestellt. Die häufigste Antwort war: Die Pandemie verläuft anders als erwartet. Das liegt auch daran, dass sich die Schweiz auf eine schwere Influenza-Pandemie vorbereitet hat. Das Szenario geht davon aus, dass man wahrscheinlich in vier Monaten einen Impfstoff haben wird. Doch plötzlich war alles anders: Es war ein neues Virus mit unklaren Krankheitsverläufen und einer höheren Ansteckungsrate und Mortalität. Zugleich lag eine Impfung in weiter Ferne. Die meisten Regierungen ergriffen drastische Massnahmen, es wurden Ausgangssperren verhängt und Grenzen geschlossen, der Markt für Medizinalgüter brach zusammen – mit diesem konkreten Szenario hat kaum jemand gerechnet.
«Das Bewusstsein für das Risiko einer Pandemie hat in den letzten 25 Jahren stark zugenommen.»Andreas Wenger
Dennoch kommen Sie zum Schluss, die Schweiz habe sich Ende 2019 in einer «soliden Ausgangslage» befunden.
Der Schweiz wurde von der WHO 2017 attestiert, sie sei gut auf eine gesundheitliche Notlage vorbereitet. Das Bewusstsein für das Risiko «Pandemie» hat in den letzten 25 Jahren stark zugenommen. Da Pandemien eine globale Herausforderung darstellen, hat man die Führungs- und Koordinationsfunktion des Bundesrates gestärkt. Das Drei-Phasen-Modell des Epidemiengesetzes mit der normalen, besonderen und ausserordentlichen Lage trägt dem Rechnung. Man war also gut vorbereitet – aber eben eher auf ein Grippeszenario als ein Virus, wie wir es nun haben.
Hätte man nicht mit einem solchen Virus rechnen müssen?
Wir sollten die Sache aus der damaligen Perspektive beurteilen, nicht aus der heutigen Sicht. Natürlich wusste man in Fachkreisen, dass so etwas passieren könnte. Aber es wäre schwierig gewesen, die Politik von der Vorbereitung auf ein solch extremes Szenario zu überzeugen. Für die Zukunft muss man sich fragen, ob man die Pandemievorbereitung nicht generischer auslegen sollte. Die WHO hat dies schon 2017 angeregt. Allerdings hat eine generische Planung auch ihre Nachteile.
Wie haben frühere Epidemien die Vorbereitung geprägt?
Wichtig waren die Erfahrungen während der Schweinegrippe 2008/09. Der Bund hat früh Impfdosen gekauft und wurde danach kritisiert, weil die Schweinegrippe überraschend mild verlief. In der Folge verlor die vorbeugende Pandemiebekämpfung an politischer und gesellschaftlicher Unterstützung. Das verdeutlicht das grundsätzliche Dilemma.
Was meinen Sie damit?
Man riskiert in einer solchen Situation immer, zu viel oder zu wenig zu machen. Bei der Schweinegrippe hat man in der öffentlichen Wahrnehmung zu viel gemacht. Aber das ist die Einschätzung im Rückblick. Hätten die Behörden zu wenig gemacht, wären sie auch kritisiert worden.
Im Bulletin wird das heikle Zusammenspiel von Bund und Kantonen immer wieder thematisiert. Wo liegt das Problem?
In unserem politischen System sind die Verantwortlichkeiten für die Bewältigung einer Pandemie auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Der Bundesrat definiert die Ziele und die Strategie, die Kantone setzen um. Da Pandemien unberechenbar sind, betont der Pandemieplan die Früherkennung und damit verbunden eine rasche Anpassung der Planungsgrundlagen. Ein solches Vorgehen braucht bereits in der Planungsphase viel Koordination. Die Experten erkennen zwar die Schwächen in der Vorbereitung, können aber ohne den Druck der Krise die Hürden des Föderalismus und die Grenzen zwischen den Departementen nicht einfach so überwinden. Dazu sind sich auch nicht legitimiert.
Das ist einer der Gründe, warum die Schweiz im Januar und Februar eher zögerlich reagierte, so wie fast alle europäischen Länder, obwohl die WHO bereits im Januar dazu aufforderte, das Krisenmanagement auf der höchsten politischen Ebene zu aktivieren. Die Fachebene hat die Signale durchaus gesehen, aber solange das Thema nicht auf der politischen Ebene ankam, kam es nur in Ansätzen zu einer koordinierten Anpassung der Planungsgrundlagen.
Hätten die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte nicht schon bei der Vorbereitung auf eine Pandemie stärker berücksichtigt werden müssen?
Das hängt mit dem Szenario zusammen, von dem man ausging. Man hat nicht vorhergesehen, dass die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahmen, die zur Bekämpfung der Pandemie ergriffen wurden, derart gravierend sein würden. Erst in der ausserordentlichen Lage konnte der Bundesrat dann eine Gesamtstrategie andenken. Er hat sich auf eine Bewältigungsstrategie geeinigt und schnell flankierende Massnahmen zugunsten der Wirtschaft beschlossen. Doch das war eben erst in der ausserordentlichen Lage möglich, in der der Bundesrat als Kollegialregierung für die Gesamtkoordination zuständig ist und über die eingespielten Mechanismen der Ämterkonsultation führt.
Ein wichtiger Punkt ist die Finanzierung. Das führt zwischen Bund und Kantonen regelmässig zu Diskussionen.
Die Kostenfrage darf nicht unterschätzt werden. Die Kantone beschwerten sich, sie würden nicht genügend einbezogen. Aus Sicht des Bundes dominierte hingegen der Zeitdruck. Man hat das in der ausserordentlichen Lage so gelöst, dass der Bund die Massnahmen vorfinanziert und die Kostenteilung später geregelt wird.
Wie funktionierte das Krisenmanagement auf der operativen Ebene?
In der Krise fanden die operativen Krisenmanager oft zu pragmatischen Lösungen. Dennoch funktionierte einiges nicht optimal. Das Problem ist, dass in der normalen, besonderen und ausserordentlichen Lage jeweils andere Organe zum Einsatz kommen. Der Bundesrat sollte in der besonderen Lage gemäss Epidemiengesetz durch ein Einsatzorgan unterstützt werden. Lange war nicht klar, welcher Krisenstab diese Funktion übernehmen soll.
Das hat man nicht vorgängig festgelegt?
Nein, das wurde nicht im Detail festgelegt. Dies auch daher, weil sich die Krisenorganisation des Bundes in den letzten Jahren dynamisch weiterentwickelte. Man hat zum Beispiel einen Ad-hoc-Krisenstab mit einem unspezifischen Mandat einberufen, weil andere Stäbe nicht richtig funktionierten. Das führte auf der operativen Ebene zu einem wackligen Gebilde.
«Als Sozialwissenschaftler finde ich, dass die Task Force breiter abgestützt sein sollte.»Andreas Wenger
Auch die Einberufung einer wissenschaftlichen Task Force war nicht vorgesehen. Wie beurteilen Sie den Einsatz dieses Gremiums?
Die Task Force leistet anerkanntermassen wichtige Beiträge. Es ist richtig, dass sie auf der strategisch-politischen Ebene angehängt ist und nicht auf der operativen. Als Sozialwissenschaftler finde ich allerdings, dass sie breiter abgestützt sein sollte. Sie deckt fachlich nicht den gesamten Prozess von der Datenerhebung bis hin zur Integration in die politischen Prozesse und die Kommunikation mit der Bevölkerung ab.
Würde die Task Force damit nicht noch stärker in das politische Geschehen involviert?
Die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik ist immer diffizil. Die Wissenschaft muss evidenzbasierte Grundlagen zur Verfügung stellen, die Politik hingegen Entscheide fällen. Das führt zwangsläufig zu Friktionen. Daher ist es sinnvoll, wenn man sich über die unterschiedlichen Rollen im Voraus verständigt.
Ein wichtiges Thema ist die Kommunikation. Welches Fazit ziehen Sie da?
Die Krisenkommunikation ist ein Bereich, den man gut vorbereiten muss. Man hat aus der Schweinegrippe viel gelernt. Während der ausserordentlichen Lage erwies sich der Pandemieplan in diesem Punkt als sehr tragfähig. Die Kommunikation wurde an wenigen Personen festgemacht, man hat einfache, klare Botschaften vermittelt und immer wieder auf Unsicherheiten hingewiesen. Das Vertrauen in den Bundesrat und die Behörden hat in dieser Phase zugenommen, die Bevölkerung verhielt sich diszipliniert.
Wie sehen Sie die Kommunikation in der jetzigen Lage?
In der besonderen Lage, die wir jetzt haben, ist die Kommunikation viel anspruchsvoller. Die Kantone müssen regionale Massnahmen kommunizieren, während der Bund für die Koordination der Gesamtstrategie zuständig ist. Sie müssen zudem bedenken: Man war auch nicht darauf vorbereitet, dass man eine derart lange Krise kommunikativ begleiten muss, in der es immer wieder ein Auf und Ab von Lockerungen und erneuten Verschärfungen gibt.
Welche Schlüsse ziehen Sie aus all diesen Erkenntnissen?
Die Schweiz hat in der ersten Phase der Corona-Krise viele Ad-hoc-Lösungen eingeführt. Wir müssen nun überlegen, welche Lösungen wir verstetigen wollen. Zentral scheint mir, dass man die Vorsorgeplanung, die Krisenorganisation und den Gesundheitsbereich genauer anschaut. Bei der Vorsorgeplanung und beim Gesundheitsbereich müssen die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen klarer geregelt werden. Bei der Krisenorganisation braucht es eine Gesamtkonzeption über die drei Phasen der normalen, besonderen und ausserordentlichen Lage hinweg.

Kommentare
Noch keine Kommentare