Eine Proteinschere für bessere Krebstherapien
Der ETH-Biologe Daniel Richter hat eine Methode entwickelt, die Proteine stabil mit einem Wirkstoff oder einem Biomarker verbindet. In Zukunft möchte er sie dazu nutzen, um Tumorzellen zu erkennen und bessere Krebsmedikamente herzustellen.
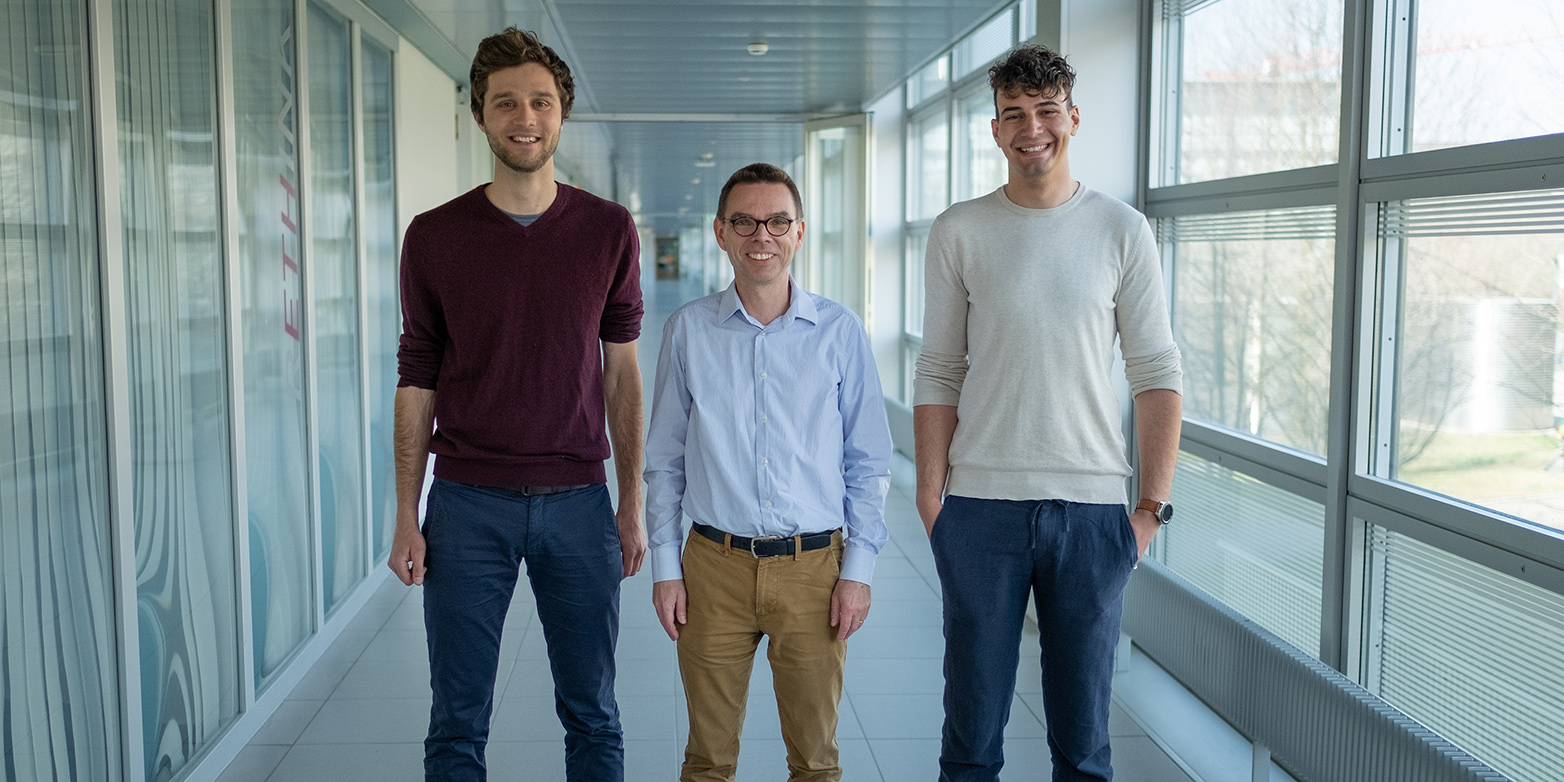
Weisse Oberflächen, bunte Flüssigkeiten in Glasbehältern und Geräte, die wie Küchenmaschinen aussehen. An den Wänden hängen Pipettiergeräte und Sicherheitsanweisungen für deren Verwendung. In einem grossen transparenten Kasten schwenkt ein Schüttelgerät mit einer grünen Flüssigkeit gefüllte Glaskolben im immer gleichen Rhythmus.
Auf den ersten Blick gleicht der Ort, an dem Daniel Richter forscht, vielen anderen Labors auf der Welt. Nichts deutet darauf hin, dass der ETH-Doktorand hier an einem biochemischen Verfahren arbeitet, das die ETH Zürich zur vielversprechendsten Erfindung gekürt hat, die im vergangenen Jahr zum Patent angemeldet wurde.
Hinter dem Verfahren stehen neben Richter der Postdoc Edgars Lakis und ETH-Professor Jörn Piel vom Institut für Mikrobiologie. Die drei Forschenden hoffen damit nicht nur den Werkzeugkasten der Pharmaindustrie beträchtlich zu erweitern, sondern auch besseren Krebstherapien zum Durchbruch zu verhelfen. Bis es so weit ist, gilt es aber noch einige Hürden zu überwinden.
Bessere Medikamente gegen Krebs
Krebs ist in vielen westlichen Ländern weiterhin die häufigste Ursache für vorzeitige Sterblichkeit. Um ihn zu behandeln, kommen häufig Chemotherapien zum Einsatz, bei denen ein Medikament das Wachstum der Tumorzellen hemmt.
Doch leider wirken diese Substanzen nicht nur auf den Tumor, sondern greifen auch gesunde Zellen an. Eine möglichst hohe Dosierung, welche die Krebszellen ganz zerstören würde, ist oft nicht möglich, da sonst auch zu viele gesunde Zellen Schaden nehmen.
An dieser Schwachstelle setzt das neue Verfahren von Richter, Lakis und Piel an: «Wir wollen Krebswirkstoffe mit spezifischen Antikörpern versehen, so dass sie nur Tumorzellen angreifen. Dadurch kann die Dosis der Wirkstoffe erhöht und Nebenwirkungen, die im schlimmsten Fall zum Abbruch der Therapie führen können, reduziert werden», erklärt Richter.
Grundlagenforschung für ein neues Enzym
Die grosse Herausforderung bei der Herstellung dieser sogenannten Konjugate ist, dass sich der Wirkstoff auf dem Weg zum Tumor an einer falschen Stelle lösen kann. Es gilt daher, eine möglichst stabile Verbindung zu finden, welche den giftigen Wirkstoff erst in der Tumorzelle freisetzt. Bestehende Antikörper-Therapien haben dieses Problem bis heute nicht ganz gelöst.
Richter und seine Kollegen wissen sich mit einem Enzym zu helfen, das die Verbindung zwischen Antikörper und Wirkstoff besonders einzigartig und stabil machen soll. Um diesen Mechanismus zu verstehen, braucht es an dieser Stelle einen Schritt zurück: Zurück zur Grundlagenforschung an der Professur für bakterielle Naturstoffe von Jörn Piel.
Piel und sein Team untersuchen Bakterien, um Enzyme zu finden, die neue chemische Reaktionen auslösen. Brandon Morinaka, damals Postdoc in Piels Gruppe und heute Professor an der National University of Singapore, wird eines Tages in Cyanobakterien fündig: Er stösst auf ein Enzym, das Proteine auf eine vorher unbekannte Weise verändert. Ein bemerkenswerter Fund der ETH-Forschenden, für den es zunächst aber keine konkrete Anwendung gibt.
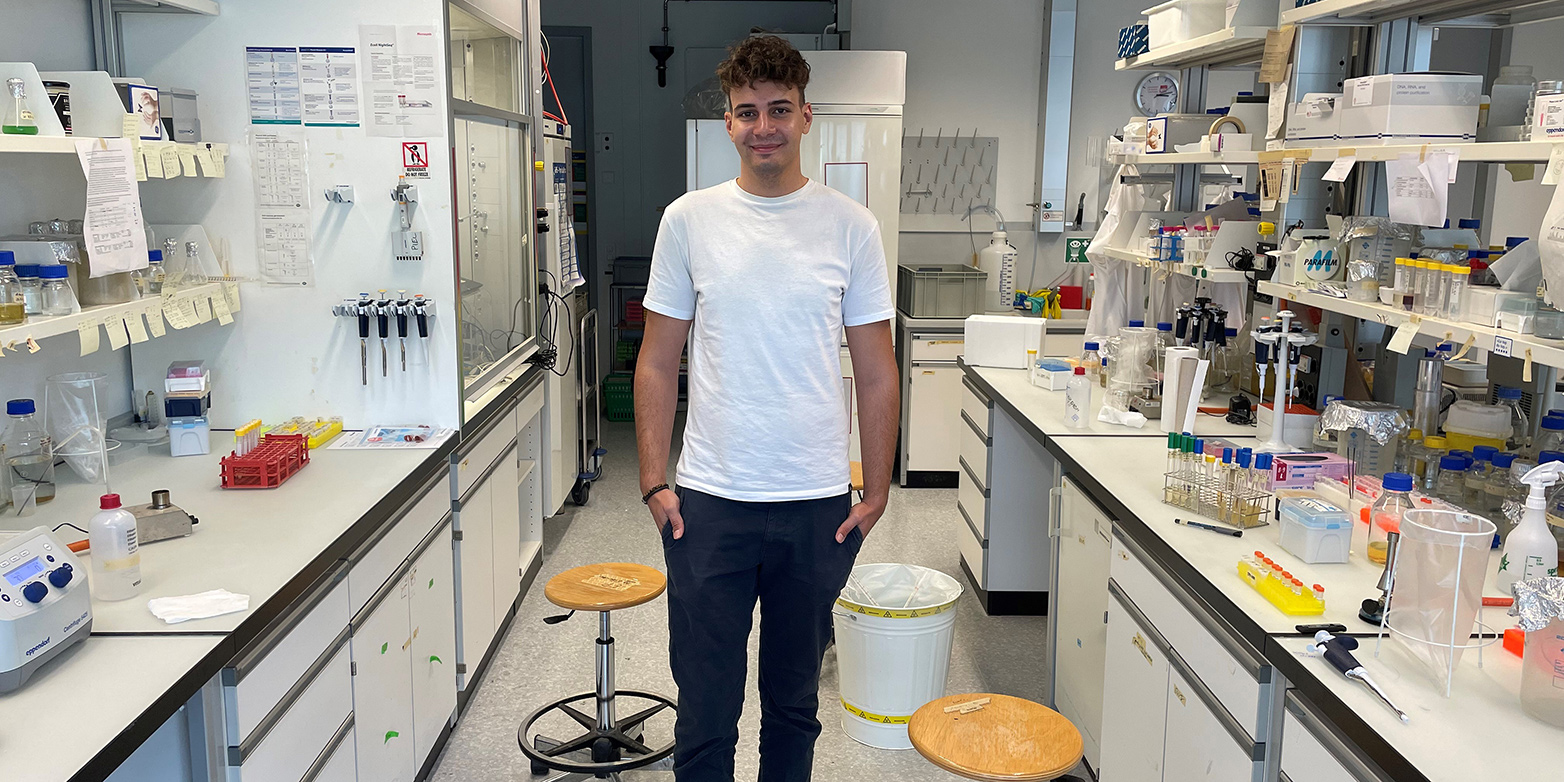
Das fehlende Puzzle-Gegenstück
Dies ändert sich, als Daniel Richter und Edgars Lakis ihre Köpfe zusammenstecken: Lakis arbeitet damals als Doktorand mit Morinaka und widmet einen Teil seiner Dissertation dem neuen Enzym. Gemeinsam mit Richter und Piel erkennt er, dass man das neue Enzym nutzen kann, um jedes Protein wie zum Beispiel Antikörper zu verändern.
Durch den Eingriff bekommen die Proteine eine einzigartige Struktur und werden damit unverwechselbar. Dies ermöglicht es, sie mit anderen spezifischen Molekülen zu verbinden. «Man kann sich das Enzym wie eine Schere vorstellen, mit der man aus einem Teil eines Proteins oder Antikörpers ein unverwechselbares Puzzleteil macht», erklärt Richter.
Hat man ein passendes Gegenstück zum Antikörper, kann man dieses Gegenstück mit einem giftigen Wirkstoff beladen, so dass dieser nur in der Krebszelle und nicht an anderen Stellen freigesetzt wird. Der 24-jährige Liechtensteiner macht es sich in seiner Masterarbeit zur Aufgabe, dieses Gegenstück zu erzeugen. Durch eine Kombination aus chemischer Logik, Versuch und Irrtum im Labor und sehr viel Fleiss wird er schliesslich fündig: Er findet das Puzzle-Gegenstück, das zum veränderten Protein passt.

Leuchtende Proteine
Den Nachweis, dass das Verfahren auch Potential für pharmazeutische Anwendungen hat, erbringen die Forschenden, indem sie zunächst ein Protein in einem Bakterium mit dem Enzym verändern und dann das Puzzle-Gegenstück mit einem fluoreszierenden Molekül verbinden. Betrachtet man das Bakterium unter dem Fluoreszenzmikroskop, sieht man die veränderten Proteine am Bildschirm grün leuchten.
Die Analyse zeigt, dass sich der Farbstoff nur mit jenen Proteinen verbunden hat, die mit dem Enzym reagiert haben. Das Besondere daran: Die Verbindung ist sehr spezifisch und stabil und kann in Zukunft auch verwendet werden, um Krebszellen zu lokalisieren. «Unsere Methode hat den Vorteil, dass wir Tumorzellen im Körper von Patienten visualisieren können, ohne eine Gewebeprobe entnehmen zu müssen», so Richter.
Mögliche Anwendungen in der Pharmaindustrie
Damit wird der Weg frei, das mehrstufige Verfahren auch für die Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und in der Diagnostik zu testen. «Mit unserer Methode können wir prinzipiell jedes Protein mit einem Wirkstoff oder einem Biomarker verbinden», erklärt ETH-Doktorand Richter.
In einem nächsten Schritt will Richter das Verfahren auf Proteine aus menschlichen oder tierischen Zellen anwenden. Sind diese Tests erfolgreich, kann er sich schliesslich krebsspezifischen Antikörpern zuwenden.
Für den jungen Forscher heisst das, dass er auch in Zukunft sehr viel Zeit in seinem Labor am Campus Hönggerberg der ETH Zürich verbringen wird, um das Verfahren zu adaptieren. Doch Richter lässt sich von dem beträchtlichen Aufwand, der noch auf ihn wartet, nicht abschrecken: «Ich bin optimistisch, dass man mit unserem Verfahren günstigere Krebstherapien entwickeln kann, die spezifischer sind und zu geringeren Nebenwirkungen führen.»
Kommentare
Noch keine Kommentare