Warum wir uns für das Klimaschutz-Gesetz positionieren

Der politische Diskurs ist entscheidend für eine funktionierende Demokratie. Gerade bei komplexen Themen wie dem Klimawandel sollten sich auch Wissenschaftler:innen mit ihrer Expertise einbringen und zur Meinungsbildung beitragen, schreibt Reto Knutti.
Mehr als 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Schweizer Universitäten und Forschungsanstalten unterstützen das Klimaschutz-Gesetz. Die Expert:innen aus den Bereichen Klima, Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie weiteren Fachrichtungen mit Bezug zum Klimawandel veröffentlichten dazu eine Stellungnahme.1
Mit dem Klimawandel haben wir ein ernsthaftes Problem. Die naturwissenschaftlichen Fakten, die gesellschaftlichen Erkenntnisse von ähnlich gelagerten Problemen sowie die technischen und wirtschaftlichen Analysen lassen keinen anderen Schluss zu: Um das Problem an der Wurzel zu packen, müssen wir die CO2-Emissionen auf Netto-Null reduzieren. Dazu hat sich die Schweiz unter dem Pariser Übereinkommen verpflichtet. Unser Land und andere Industrienationen stehen in der Verantwortung, denn wir haben das Problem mitverursacht. Zudem haben wir die finanziellen und technischen Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Die Schweiz hat eine Vorbildrolle - was wir tun, macht einen Unterschied. Und: Wenn wir uns engagieren, werden wir davon profitieren.
Das Klimaschutz-Gesetz stärkt die Schweiz
Aus Erfahrung wissen wir: Bei Umweltproblemen reichen Eigenverantwortung und spontane Innovation nicht aus. Von Abfall, Abwasser und Luftqualität über das Ozonloch, Phosphat und Asbest bis hin zur Pandemie: Immer war ein politischer Rahmen nötig, damit alle zur Lösung beitragen, die dann auch allen zugutekommt. Nach Jahren des politischen Stillstands haben die Stimmbürger:innen am 18. Juni die Chance, die Schweiz in Sachen Klima- und Energiepolitik einen wichtigen Schritt voran zu bringen.
«Gerade bei Volksentscheiden, in denen wissenschaftliche Zusammenhänge eine zentrale Rolle spielen, ist es wichtig und richtig, dass auch Wissenschaftler:innen dazu Stellung nehmen und einordnen.»Reto Knutti
Das Klimaschutz-Gesetz2 ist breit abgestützt. Es schafft Verbindlichkeit und Planungssicherheit, fördert zukunftstaugliche Innovation und erhöht gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen. In vielen Bereichen setzt das Klimaschutz-Gesetz den Weg fort, den international tätige Schweizer Firmen heute schon erfolgreich gehen. Es reduziert die Risiken, erhöht die Energiesicherheit und leistet einen Beitrag zu einer lebensfreundlichen Welt.
Kurz: Mit dem Klimaschutz-Gesetz stärken wir die Schweiz. Davon bin ich überzeugt, ebenso wie die mehr als 200 Wissenschaftler:innen, die unseren Vorstoss stützen. In unserer Stellungnahme zeigen wir auf, warum wir das tun.1
Kontext liefern und einordnen
In der Vergangenheit wurde oft kritisiert, wenn Wissenschaftler:innen sich in politische Debatten einbringen. Solch aktivistische “Einflussnahme” sei unsachlich, ja zutiefst anti-wissenschaftlich. Wissenschaftler:innen sollten vorurteils- und wertfrei forschen, sich politisch aber nicht äussern.
Ich zähle mich zu jenen Fachleuten, die ihre Aufgabe anders verstehen: Gerade weil wir Wissenschaftler:innen sind, erachten wir es als unsere Pflicht, uns einzumischen. Voraussetzung dafür ist, dass wir über die nötige Expertise verfügen und aus wissenschaftlicher Sicht argumentieren. Während Politiker:innen gerne auf unsere Expertise zurückgreifen, ist sie für die breite Öffentlichkeit weit weniger verfügbar. Gerade bei Volksentscheiden, in denen wissenschaftliche Zusammenhänge eine zentrale Rolle spielen, ist es wichtig und richtig, dass auch Wissenschaftler:innen dazu Stellung nehmen und einordnen.
Als Forschende erarbeiten wir primär Grundlagen, aber auch Entscheidungshilfen und Lösungen. Wir denken in Szenarien, bewerten Optionen und analysieren Kosten, Nutzen und Risiken. Die Ziele legen Politik und Gesellschaft fest. Doch nicht jede Situation lässt sich wissenschaftlich isoliert und nüchtern betrachten. Denn oft sind gesellschaftliche Prioritäten im Spiel. Insbesondere beim Klimawandel kann Forschung heute kaum mehr unpolitisch sein: Die Aussage, dass die Schweiz ihre CO2-Emissionen rasch reduzieren muss, ist einerseits eine rein logische Schlussfolgerung aus der Physik und der Verpflichtung aus dem Übereinkommen von Paris, das die Schweiz ratifiziert hat, und andererseits als Forderung politisch.
«Entscheidend ist, dass wir bei unserer Interpretation die Werte, Prioritäten und Kriterien transparent machen und auch mögliche andere Bewertungen diskutieren.»Reto Knutti
Der Anspruch, dass Wissenschaft völlig wertefrei sein muss, ist weder möglich noch wünschenswert. Forschung muss wissenschaftlichen Prinzipien genügen, objektiv und reproduzierbar sein. Jede Forschung wird jedoch unweigerlich durch das gesellschaftspolitische Umfeld geprägt. Entscheidend ist, dass wir bei unserer Interpretation die Werte, Prioritäten und Kriterien transparent machen und auch mögliche andere Bewertungen diskutieren.3
Nicht zuletzt kommt der modernen Wissenschaft auch eine Rolle als Fakten-Checker zu: In einer Zeit, in der vermeintliche Realitäten und gezielte Desinformation auf Plakaten und sogar auf offiziellen Partei-Webseiten verbreitet werden, müssen Forschende mit ihrer Expertise klarstellen, was stimmt und was nicht. Tun wir es nicht, werden andere Akteure mit Partikulärinteressen ihre eigenen Interpretationen liefern.
Dialog und Kommunikation als Auftrag
Der ETH-Bereich hat einen strategischen Auftrag «Engagement und Dialog mit der Gesellschaft»4, und auch die Politik will den Austausch mit der Wissenschaft stärken.5, 6 Basis dafür ist Transparenz, gegenseitiges Vertrauen und ein Verständnis der Rollen. Dass dabei Spannungsfelder entstehen, ist unvermeidlich.
In der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen, könnte in gewissen Kreisen unsere Glaubwürdigkeit beeinträchtigen.7 Schweigen fordert jedoch einen viel höheren Preis: für den Planeten, für die Gesellschaft und für den Wert von Fakten und Wissenschaft im politisch-medialen Diskurs.
Wir erachten das Klimaschutz-Gesetz als wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Deshalb bringen wir uns ein und tragen zu einer faktenbasierten Meinungsbildung bei.
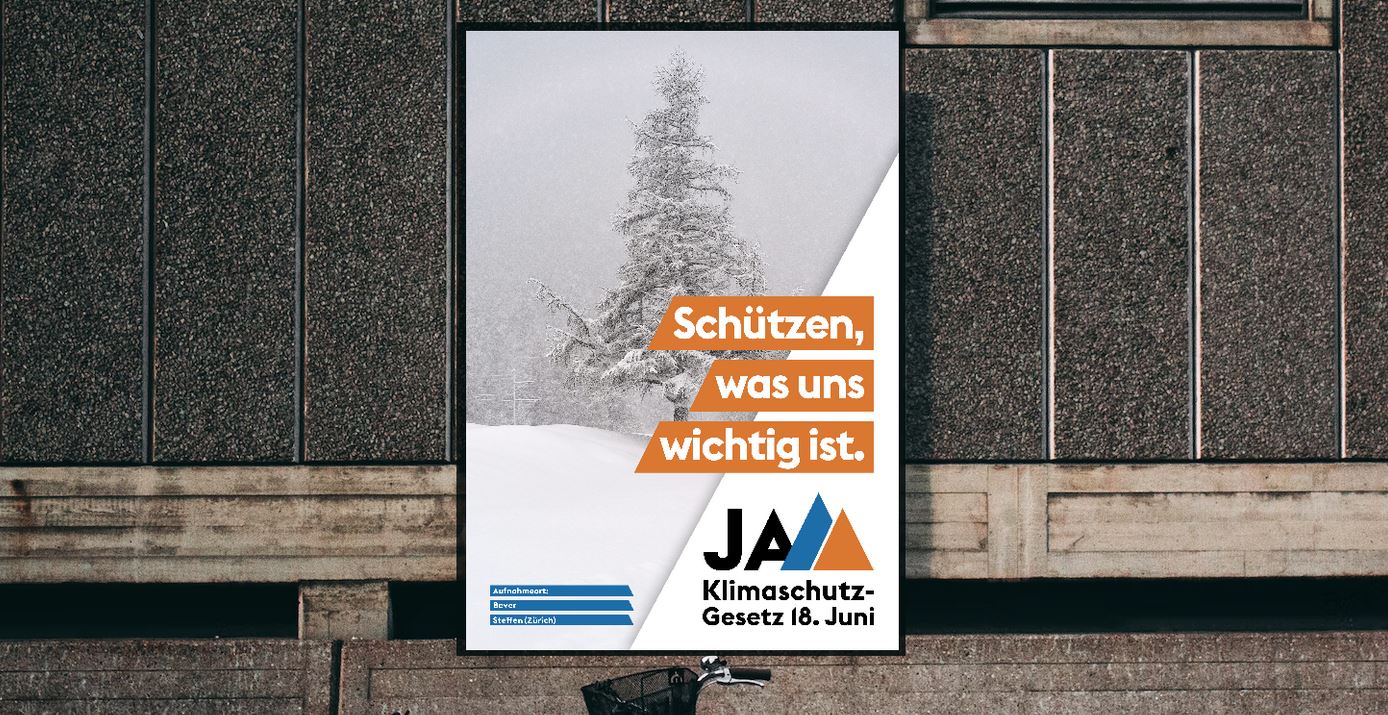
Kommentare
Noch keine Kommentare