Netto Null braucht einen Plan
Mit einem Fernziel für 2050 allein erreichen wir die Klimaneutralität kaum, sagt Reto Knutti. Die Politik muss nun den Kurs konsequent auf Netto Null ausrichten und einen Absenkpfad mit konkreten Massnahmen und Zwischenzielen definieren.

Nach dem Scheitern des CO2-Gesetzes im Juni steht die Schweizer Politik vor grossen Herausforderungen. Einerseits soll das Zwischenziel von 50 Prozent Reduktion der Treibhausgase bis 2030 weiterhin erreicht werden. Wie, ist man sich noch nicht einig. Andererseits steht die Abstimmung zur Gletscher-Initiative an. Diese verlangt, das Ziel «Netto Null 2050» in die Verfassung zu schreiben. Damit dürfte die Schweiz ab 2050 nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als natürliche und technische CO2-Senken aufnehmen können.
Die Chancen der Initiative stehen gut, immerhin hat der Kanton Bern dieses Ziel vor ein paar Wochen klar angenommen. Auch der Bundesrat hat in seinem direkten Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative das Ziel Netto Null 2050 aufgenommen, aber die Einigkeit täuscht. Das Parlament muss in der Diskussion des Gegenvorschlages in den nächsten Wochen wichtige inhaltliche Punkte klären.

Massgebend ist das CO2-Budget
Erstens ist für die Erwärmung am Ende nicht nur der Zeitpunkt von Netto Null relevant, sondern wie viele Emissionen wir insgesamt ausstossen. Jede Tonne CO2 erwärmt die Erde, egal, wann und wo sie ausgestossen wird. Die Gletscher-Initiative wie der Gegenvorschlag verlangen darum einen mindestens linearen Absenkpfad. Dieser ist ein zentrales Element, um die totalen Emissionen zu begrenzen.
Entscheidend wäre hier, einen Startpunkt für den linearen Absenkpfad festzulegen, doch ein solcher ist im Moment weder in der Gletscher-Initiative noch im Gegenvorschlag bestimmt. Gibt es nur den Zeitpunkt für Netto Null, dann droht eine Politik des Abwartens bis 2040, nur um dann zu realisieren, dass die aufsummierten Emissionen zu hoch und eine rasche Reduktion auf null nicht mehr möglich sind.
Das CO2-Budget zeigt also, wie viel wir insgesamt für ein vorgegebenes Temperaturziel ausstossen dürfen. Die «erlaubten» CO2-Emissionen sind mitunter auch abhängig von den Massnahmen für andere Treibhausgase, von der Wahrscheinlichkeit, mit der wir das Ziel erreichen und davon, was ein fairer Beitrag der Schweiz an die globalen Anstrengungen sein soll. Selbst im optimistischsten Fall, wenn man global gleiche Emissionen pro Kopf für die Zukunft annimmt, sind die in der langfristigen Klimastrategie des Bundesrates vom Januar 2021 vorgesehenen Emissionen rund 40 Prozent über dem, was für 1.5 Grad Celsius nötig wäre.
Wenn man mit dem Prinzip der «gemeinsamen aber differenzierten Verantwortung» der UN-Rahmenkonvention argumentiert und die vergangenen Emissionen sowie die technischen und finanziellen Möglichkeiten einbezieht, müsste die Schweiz noch schneller reduzieren.
Zum Vergleich: Führen wir das bisherige Reduktionstempo fort, wären wir sogar 2.5-mal zu hoch. Wir sind also nicht auf Kurs. Würden die Emissionen bis 2030 halbiert und sänken danach linear bis 2050 auf netto null, lägen die totalen Emissionen noch etwa 15 Prozent zu hoch. Das ist aus meiner Sicht das Mindeste, was die Schweiz leisten muss und woran sich alle Vorschläge orientieren müssen.
Ein Verbot der Fossilen wäre wegweisend
Zweitens verlangt die Gletscher-Initiative den Ausstieg aus der fossilen Energie. Der Gegenvorschlag will deren Nutzung lediglich «reduzieren», soweit es «wirtschaftlich tragbar» ist. Wirtschaftlich tragbar ist nicht gleichbedeutend mit rentabel, aber die Formulierung bietet zu viel Spielraum für Ausreden, der Umstieg sei zu teuer.
Zudem will der Gegenvorschlag Ausnahmen für Rettungsdienste und Landesverteidigung. Diese Ausnahmen sind unnötig, denn CO2-neutrale synthetische Treibstoffe gibt es heute schon. Bis 2050 bleibt genügend Zeit, die nötigen Produktionskapazitäten aufzubauen. Die von der Schweiz und der EU diskutierten Beimischquoten beim Kerosin schaffen solche Anreize. Aber auch ein lang angekündigtes Verbot ist ein starker Anreiz, Alternativen zu entwickeln, und schafft Planungssicherheit.
Was wir versäumen, belastet unsere Kinder
Drittens bleibt die Frage, wer bezahlen wird, und welche Anreize wirksam sind. Jede Tonne CO2 verursacht gemäss dem deutschen Umweltbundesamt über die Zeit und global aggregierte Klimaschäden von rund 200 Franken. Neueste Berechnungen liegen sogar deutlich höher.1
Zusätzlich muss jede Tonne, die das CO2-Budget für ein Temperaturlimit überstrapaziert, irgendwann wieder aus der Luft entfernt werden (netto negative Emissionen). Von heute rund 600 Franken werden diese Preise hoffentlich für unsere Nachkommen auf 200 Franken fallen, aber selbst dann verursachen wir ihnen Kosten von Hunderten Franken pro Tonne. Aktuell gibt es lediglich eine Lenkungsabgabe von rund 100 Franken pro Tonne auf fossilen Brennstoffen, nicht jedoch auf Treibstoffen und Kerosin.
Kurz: Wir bezahlen nur einen Bruchteil der effektiven Kosten der fossilen Energie und überlassen die Rechnung den jungen Generationen. Ein Modell mit einer «vorgezogenen Entsorgungsgebühr» ähnlich wie sie heute im Kleinen bei elektronischen Geräten besteht, würde die CO2-Vermeidung beschleunigen, Alternativen fördern, und unseren Kindern das Aufräumen erleichtern.2 Wo eine Lenkung über den Preis nicht mehrheitsfähig oder mangels Alternativen nicht ausreichend ist, braucht es Investitionsprogramme und Grenzwerte.3
Negative Emissionen gibt es nicht umsonst
Viertens gibt es entscheidende offene Fragen zu den negativen Emissionen: Wie viel Treibhausgase lassen sich künftig nicht oder nur sehr schwer vermeiden? Welches Potenzial haben natürliche Senken und technische Verfahren, um der Atmosphäre das CO2 wieder zu entnehmen? Was sind die Kosten? Wie geht man mit nicht permanenten Senken wie Wäldern und Böden um? Und müssen negative Emissionen stets im Inland erfolgen, auch wenn wie in der Schweiz geeignete geologische Lager begrenzt und die Sequestrierung teuer sind?
Vieles ist unklar. Dennoch müssen wir diese Technologien bereits heute entwickeln und skalieren, wollen wir sie morgen wirkungsvoll nutzen. Ähnlich wie bei der Photovoltaik wird es ein bis zwei Jahrzehnte dauern, bis die Verfahren günstig und breit verfügbar sind. Wir müssen jetzt damit beginnen.
Riskantes politisches Pokerspiel
Schliesslich steht viel auf dem Spiel: Ein reines Netto-Null-Ziel in der Verfassung würde weitere Schritte auf Gesetzesebene für die Umsetzung benötigen, was ähnlich umstritten wäre wie beim CO2-Gesetz. Kommen Gletscher-Initiative und Gegenvorschlag vors Volk, besteht zudem das Risiko eines doppelten Neins. Das wäre für die Schweiz und ihre Reputation fatal.
«Das Teuerste beim Klimaschutz ist, nichts zu tun.»Reto Knutti
Die Alternative, wie sie die Umweltkommission des Nationalrats nun vorschlägt, ist ein indirekter Gegenvorschlag auf Gesetzesebene, der die Gletscherinitiative überflüssig machen könnte. Was im Parlament am Schluss mehrheitsfähig sein wird, steht in den Sternen.
Fest steht: Mit der Ratifizierung des Pariser Übereinkommens muss die Schweiz ihren Beitrag zu einem globalen Netto-Null-Ziel leisten. Mit ihren Mitteln und ausgezeichneten Möglichkeiten als Innovationsstandort kommt ihr dabei eine Vorreiterrolle zu. Und es lohnt sich langfristig: Das Teuerste beim Klimaschutz ist, nichts zu tun.
Trotz allen Unsicherheiten und Befindlichkeiten nach dem verlorenen CO2-Gesetz: Bundesrat und Parlament sind gefordert, bei den Vorlagen zur Gletscher-Initiative die Weichen konsequent auf Netto Null zu stellen und neben dem Fernziel für 2050 Massnahmen und Zwischenziele zu erarbeiten. Wir können den Klimaschutz nicht länger auf die lange Bank schieben.
Eine kürzere Version dieses Meinungsbeitrages erschien am 10.10.2021 in der externe Seite NZZ am Sonntag.
Referenzen
1 Jarmo S Kikstra et al 2021. externe Seite The social cost of carbon dioxide under climate-economy feedbacks and temperature variability. Environmental Research Letters 16 094037.
2 David A. Stainforth. externe Seite Polluter pays’ policy could speed up emission reductions and removal of atmospheric CO2. Nature 2021
3 Beitrag im Zukunftsblog von Anthony Patt und Johann Lilliestam: Eine Alternative zu CO2-Steuern
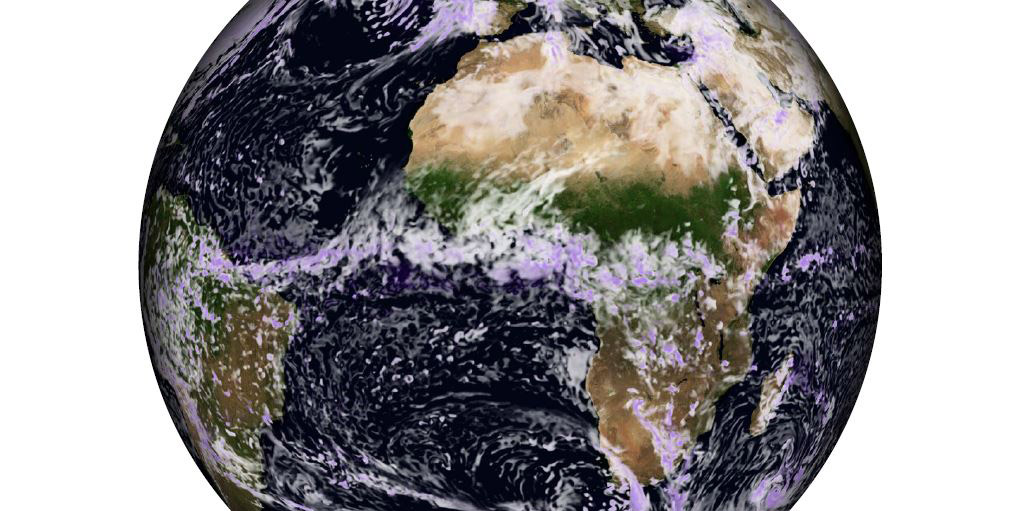
Kommentare
Noch keine Kommentare