Netto-Null-Ziel erfordert schnelle Investitionen
Eine neue Studie von ETH-Forschenden zeigt: Wenn Europa nicht so schnell wie möglich 302 Milliarden Euro in klimarelevante Infrastrukturen investiert, wird es sein Ziel von netto Null Treibhausgasemissionen bis 2050 verfehlen.
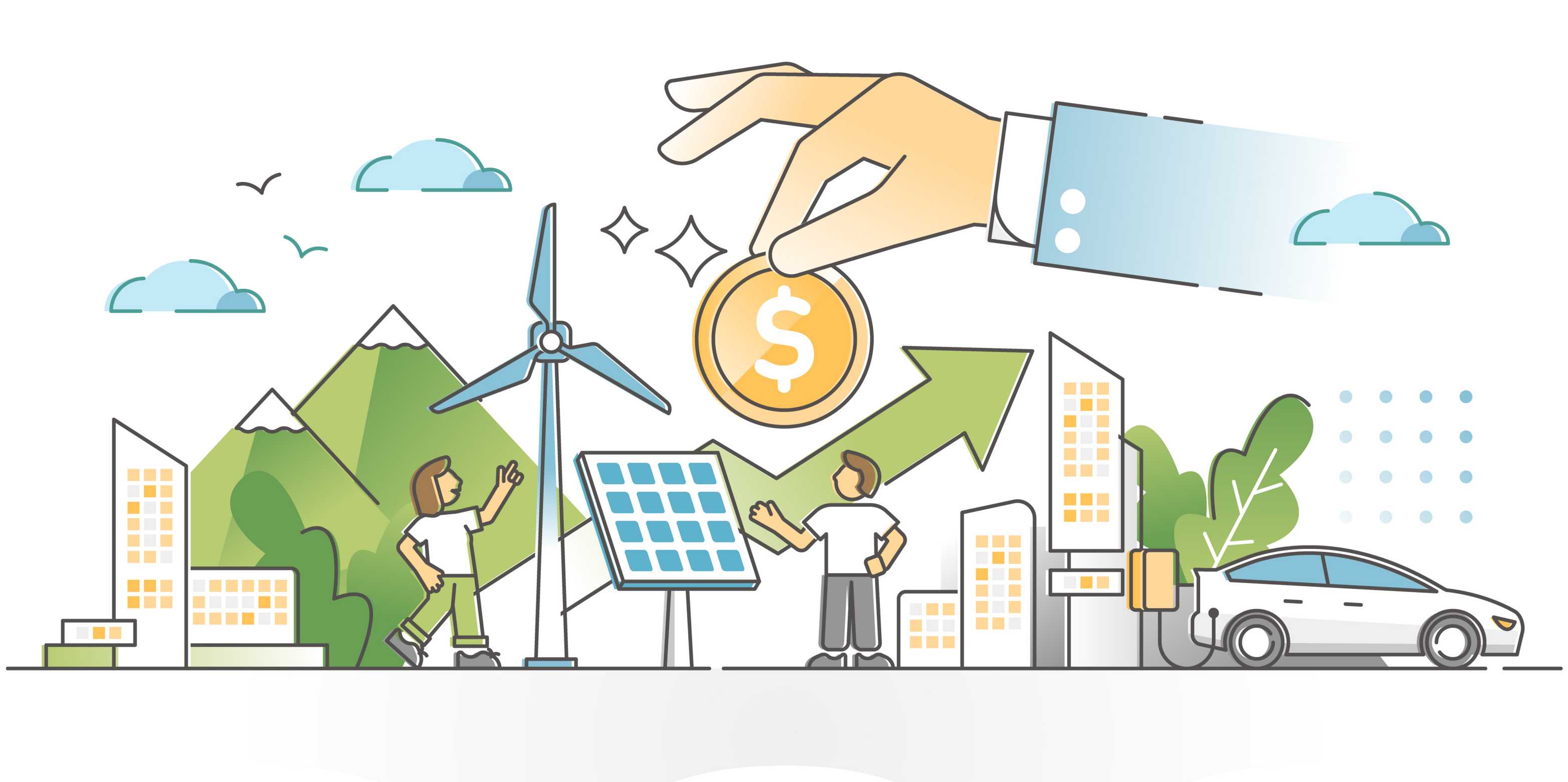
Sowohl die Europäische Union als auch die Schweiz haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden und ihre Treibhausgasemissionen auf Netto-Null zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sind grosse Investitionen in die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, die Stromnetze, Speicherkapazitäten und andere klimarelevante Infrastrukturen erforderlich. Wie hoch diese aber in den nächsten 15 Jahren ausfallen müssen und welche Bereiche dabei am wichtigsten sind, war bis anhin unklar.
Diese Lücke füllt nun eine Meta-Studie von ETH-Professor Bjarne Steffen und Lena Klaaßen, die kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Climate Change erschienen ist. Die Autoren kommen zu dem Schluss: Wenn in den nächsten zwei Jahren nicht jährlich 302 Milliarden Euro in klimarelevante Infrastrukturen in Europa fliessen, ist das Netto-Null-Ziel gefährdet.
Ein Drittel mehr Investitionen nötig
«Im Vergleich zu den letzten Jahren müssen die Investitionen in grüne Infrastrukturen pro Jahr um 87 Milliarden steigen und das so schnell wie möglich. Das sind über ein Drittel mehr als bisher», erklärt Erstautorin Klaaßen, die an der Professur für Klimafinanzierung der ETH Zürich doktoriert. Angesichts der Grösse der europäischen Aktien- und Anleihemärkte ist das Geld dafür vorhanden. Die Herausforderung bestehe aber vor allem darin, die nötigen politischen Weichen schnell genug zu stellen, damit das Kapital in die richtigen Projekte fliesst.
Die ETH-Forschenden untersuchten 56 Technologie- und Investmentstudien aus der Wissenschaft, der Industrie und dem öffentlichen Sektor. Sie konzentrierten sich dabei auf die Staaten der EU, berücksichtigen aber auch Daten zum Vereinigten Königreich, zu Norwegen und zur Schweiz. Die gesamteuropäischen Trends sind daher auch für die Schweiz relevant.
Drei Bereiche sind besonders relevant
Am deutlichsten steigt der Investitionsbedarf bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. «Um die Entkarbonisierung aller Lebensbereiche voranzutreiben, müssen in den nächsten Jahren jährlich rund 75 Milliarden in Solar- und Windkraftanlagen fliessen. Das sind 24 Milliarden mehr pro Jahr als in der jüngeren Vergangenheit», sagt Steffen.
Ähnlich sieht es beim Ausbau der Verteilnetze und der Eisenbahn aus: Auch in diese Bereiche müssen verglichen mit dem Zeitraum 2016 bis 2020 40 - 60 Prozent mehr Mittel fliessen, um die Elektrifizierung und die Verlagerung des Verkehrs von der Strasse auf die Schiene auszuweiten.
«Im Vergleich zu den letzten Jahren müssen die Investitionen in grüne Infrastrukturen pro Jahr um 87 Milliarden steigen und das so schnell wie möglich.»Lena Klaaßen
Ukrainekrieg verstärkt Trends
Den Autoren zu Folge verstärkt der Krieg in der Ukraine diese Trends zusätzlich: «Um möglichst wenig Gas aus Russland zu importieren, müsste Europa rund 10 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich in die Solarenergie und die Windkraft investieren. Im Vergleich dazu ist der Investitionsbedarf für zusätzliche Erdgasinfrastruktur wie LNG-Terminals mit rund 1,5 Milliarden pro Jahr deutlich geringer», sagt Steffen.
Laut der ETH-Studie sollten fossile Energieträger wie Kohle, Öl- und Gas in Europa in Zukunft weniger Kapital binden. Insbesondere der Investitionsbedarf in konventionelle Kraftwerke sinkt um 70% innerhalb weniger Jahre.
Regulierung auf unterschiedliche Bereiche zuschneiden
Was kann die Politik tun, damit schnell mehr Kapital für den Ausbau grüner Infrastrukturen zur Verfügung steht? «Politische Massnahmen sollten auf die Finanzierung in jenen Sektoren zugeschnitten sein, wo der grösste Investitionsbedarf besteht», erklärt Klaaßen. Dies sei heute nicht selbstverständlich: So konzentrieren sich bestehende Regulierungen in der EU auf die Identifikation nachhaltiger Wertpapiere, obwohl wichtige klimarelevante Infrastrukturen gar nicht über Aktienmärkte finanziert werden.
Der Ausbau erneuerbarer Energien wird hingegen oft durch private Investoren wie Pensionsfonds und Banken ermöglicht. Die öffentliche Hand sollte deren Risiko durch Erlösgarantien und durch möglichst rasche und berechenbare Bewilligungsverfahren minimieren. Zudem können öffentliche Investitionen in neue Technologien wie zum Beispiel die CO2-Speicherung dazu beitragen, dass sich auch private Investoren in diese Bereiche vorwagen.


Kommentare
Die Frage wieviel investiert werden müsste, bleibt absolut theoretisch, wenn man sich nicht überlegt, wer die Investitionen den umsetzen soll! Vor allem auch im Bereich PV-Anlagen und Wärmepumpen werden massiv handwerkliche Fachkräfte fehlen. Da kann es noch so viele willige Investoren geben. Ich wundere mich immer wieder, dass hier keine entsprechenden Modelle erstellt werden. Zumindest in der Schweiz. Hat man Angst vor den Schlussfolgerungen? In Deutschland gibt es zumindest mal eine Zahl: Es fehlen 216'000 Fachkräfte: https://www.iwkoeln.de/studien/anika-jansen-energie-aus-wind-und-sonne-welche-fachkraefte-brauchen-wir.htmlcall_made
Meine Fragen betreffen die Durchführbarkeit. Sind dann genug Produktionskapazität und Ressourcen für die Installation der EE-Anlagen vorhanden, um diese Investitionen im geplanten Zeitfenster überhaupt realisieren zu können? Und wenn ja, welcher Impact hätte eine notwendige Umschichtung von Ressourcen auf die Gesamtwirtschaft?
Es gibt Studien, die feststellen, dass für die EE-Anlagen und E-Autos die Rohstoffe schon bald knapp werden und einige sogar bald mangels ausreichend bekannter Lagerstätten zu Ende gehen könnten. Hier eine neue Studie: https://doi.org/10.1016/j.geogeo.2022.100136call_made Bei der IEA können Sie eine Studie zu den EE-Rohstoffen finden, in der die massive Abhängigkeit von China anhand der Zahlen nachzulesen ist. Außerdem ist ein riesiges Problem, auch bei unbegrenzt vielen Rohstoffvorkommen, die Förderkapazität der Rohstoffe entsprechend zu erhöhen, da dies nicht innerhalb kurzer Zeit möglich ist und Jahre bis Jahrzehnte dauern würde oder wird.