Die Natur ist Kultur
Christophe Girot wächst in der Nähe des Londoner Richmond Parks auf. Die Wälder, Pfade und Wiesen im Südwesten der Stadt sind wie eine zweite Heimat für ihn. Mit elf Jahren zieht er mit seiner Familie nach Versailles. Was ihn dort erwartet, könnte unterschiedlicher nicht sein: hier die gezähmte Wildnis englischer Gärten, dort die absolutistische Strenge des Versailler Schlossgartens.
Girot ist schon in jungen Jahren beeindruckt davon, wie verschieden man Landschaften gestalten kann. Die gegensätzlichen Eindrücke, die er in Paris und London sammelt, sensibilisieren ihn dafür, dass jede Kultur ihre eigene Wahrnehmung von und Haltung gegenüber der Natur hat. «Die Natur ist dem Menschen immer Kultur», schreibt er später dazu.
Jenseits des Gartenzauns
Für sein Studium zieht es Girot in den frühen 80er-Jahren an die U.C. Berkeley in Kalifornien. Er absolviert einen Doppelmaster in Architektur und Landschaftsarchitektur. Das Verhältnis der beiden Disziplinen lässt ihn seit dieser Zeit nicht mehr los: «Es gab damals kaum einen Dialog. Landschaftsplanung war vom Natur- und Heimatschutz geprägt, während in der Architektur die Postmoderne anbrach und sich Architekt:innen in ihrer Formsprache immer radikaler von der Umwelt abgrenzten» erinnert er sich.
Für Girot ist schon damals klar, dass die beiden Disziplinen zusammengehören, wie zwei Seiten der gleichen Medaille. «Sobald der Mensch sesshaft wird und sich ein fixes Dach über dem Kopf baut, muss er auch die Umgebung gestalten, indem er Felder anlegt, Wälder rodet und Wiesen pflegt. Auch heute noch beginnt Landschaftsarchitektur mit der Überwindung des Gartenzauns», so Girot.
Entwurf des Berliner Invalidenparks
Nach zehn Jahren in den Vereinigten Staaten kehrt er 1990 nach Versailles zurück und übernimmt dort die Professur für Landschaftsarchitektur an der Ecole Nationale Supérieure de Paysage. Mit seinem Atelier «Phusis» ist Girot in dieser Zeit auch als Praktiker tätig und entwirft Parks in Paris und einigen kleineren französischen Ortschaften.
Seinen bis dahin grössten Erfolg feiert der Landschaftsarchitekt 1992 mit seinem Entwurf des Berliner Invalidenparks für den er später mit dem Fritz-Schumacher-Preis ausgezeichnet wird. Dass die Deutschen einen Franzosen damit beauftragen, diesen symbolischen Ort an der Grenze zwischen Ost- und West-Berlin neu zu gestalten, galt damals als Sensation.
Besonders markant an Girots Entwurf ist das grosse Wasserbecken, in dem eine Granitmauer zu versinken scheint. «Der Park schuf einen Ort der Begegnung in der erst seit wenigen Jahren wiedervereinigten Stadt und erinnert gleichzeitig an die Berliner Mauer, die ganz in der Nähe stand», erklärt er.

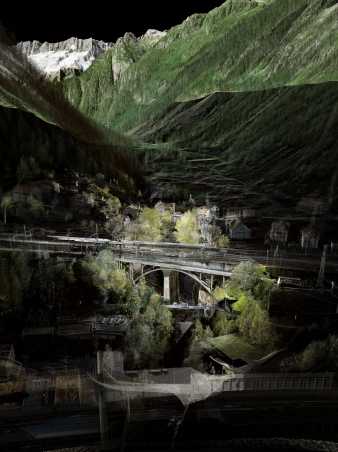



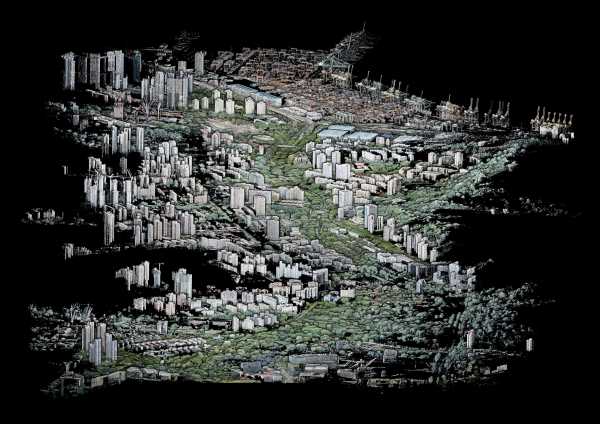








Kommentare
Schade, dass ich diesen Professor in seiner Zeit an der ETH nicht kennenlernen konnte. Meiner Meinung nach hat er Recht damit, dass die Landschaftsarchitektur eine grosse Bedeutung hat und noch viel wichtiger werden wird in Bezug auf die Lebensqualität während der Klimaerwärmung. Schön ist, dass für Herrn Girot das Wohlbefinden der Menschen prioritär ist, er Räume als Orte wahrnimmt und auf deren Ganzheit und Individualität eingeht.